08. März 2021
Eine Geschichte sozialer Wohnpolitik
Mit der aufkommenden Arbeiterbewegung rückten auch die Wohnverhältnisse der Menschen ins Zentrum. Bis heute wird darum gerungen, das Wohnen der Logik des Marktes zu entziehen. Doch welcher Ansatz verspricht den größten Erfolg?
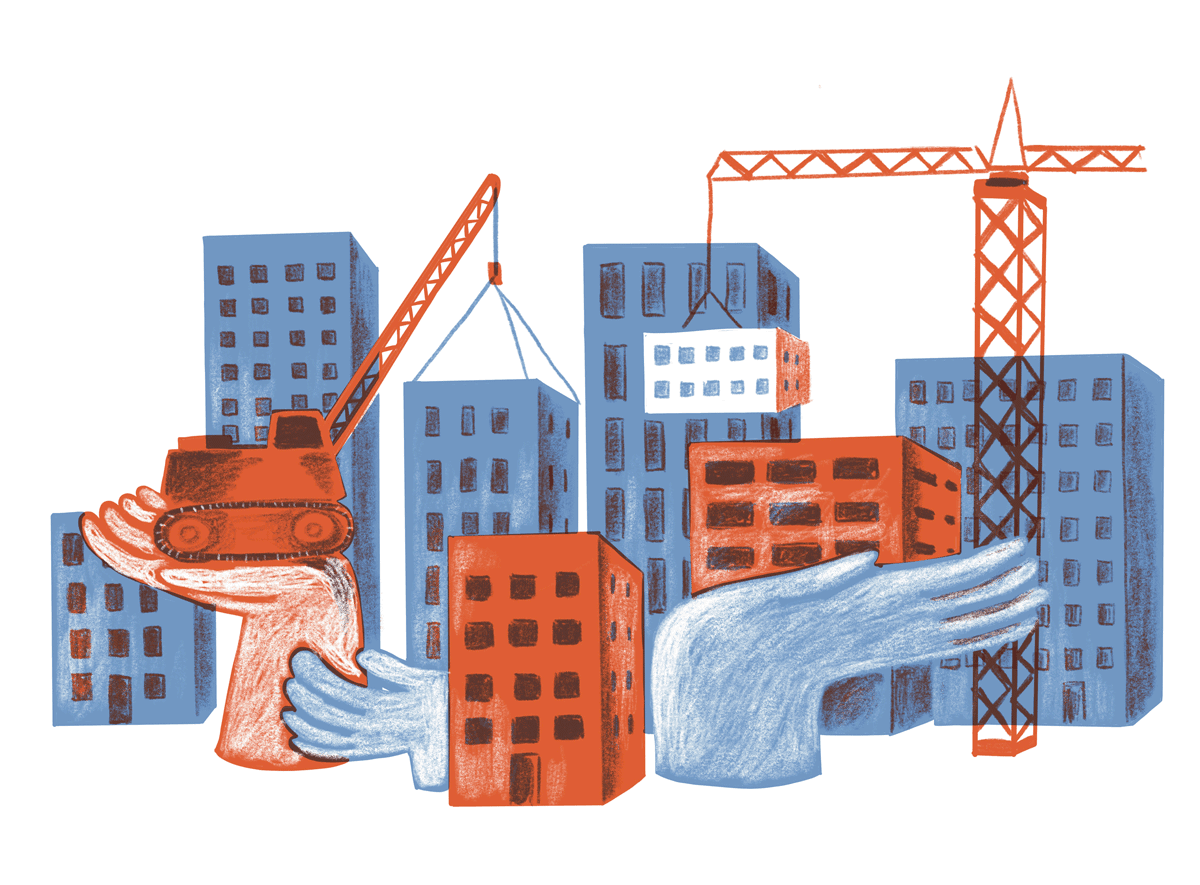
Was macht eine Wohnungspolitik sozialistisch?
Anfang des Jahres meldete die Berliner »Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen« fast täglich den Druck von neuen Flyern und Plakaten. Die knallgelben Plakate mit den großen Schriftzügen sind nun überall in der Stadt zu sehen. Sollte die Initiative Erfolg haben – so jedenfalls die Befürchtung von Wirtschaft, Politik und vielen Medien – droht sie eine neue Phase des Sozialismus in Berlin einläuten.
Die Sorgen der Immobilienwirtschaft sind nicht ganz unbegründet, denn tatsächlich versuchen Sozialistinnen und Sozialisten schon seit über einem Jahrhundert, durch die demokratische Verwaltung und Verteilung von Wohnraum und Wohneigentum allen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Der Vorstoß, mit politischen Instrumenten in den Berliner Wohnungsmarkt einzugreifen, reiht sich ein in eine lange Geschichte linker Bewegungen und sozialer Wohnungspolitik, die uns auch heute dabei hilft, darüber nachzudenken, wie eine moderne sozialistische Antwort auf die Wohnungsfrage aussehen kann.
Wie Enteignung die Koordinaten verschiebt
Im Februar begann die zweite Stufe des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Bis Ende Juni 2021 müssen über 170.000 Unterschriften zusammenkommen, um den geplanten Volksentscheid zu ermöglichen. Zur Abstimmung steht dann die Aufforderung an den Berliner Senat, »alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz erforderlich sind«. Gegenstand der Sozialisierungsforderung sind die rund 240.000 Wohnungen, die zurzeit von großen Wohnungskonzernen verwaltet werden.
Schon bei der Ankündigung der Initiative für einen Volksentscheid war die Aufregung groß. Die Neue Zürcher Zeitung befürchtete ein »Einfallstor zum Sozialismus«, das Manager Magazin sah die Berliner Wohnungspolitik auf dem Weg in eine »DDR 2.0« und auch der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder empörte sich über den Vorschlag der Initiative zur Sozialisierung von größeren Wohnungsbeständen: »Enteignungen sind nun wirklich sozialistische Ideen und haben mit bürgerlicher Politik nichts zu tun.« Das Grundeigentum – das Organ des Bundes der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine – gestaltete ihre Ausgabe zur Enteignungsinitiative gleich mit einem Titelblatt-füllenden Chavez-Konterfei und warnte vor Verhältnissen wie in Venezuela.
»Die Reaktionen auf Mietendeckel und Enteignungskampagne verwundern kaum, schließlich sind sie mit drastischen Einschränkungen für das bisherige Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft verbunden. Im Gegensatz zu Wohngeldzahlungen.«
Fast gleichlautend waren die Reaktionen auf den Beschluss, in Berlin einen Mietendeckel – also eine landesrechtlich festgelegte Höchstmiete – einzuführen. In der Zeit wurde über einen »Sozialismus durch die Hintertür« sinniert, die Wirtschaftswoche berichtete über einen »gigantischen Feldversuch des Immobilien-Sozialismus«. Ein Freiburger Professor für Wirtschaftswissenschaften kritisierte den Mietendeckel als »Politik aus der sozialistischen Mottenkiste« und wünschte sich stattdessen lieber weniger Regulierungen. Um die Wohnungskrise zu überwinden, müssten vor allem Investitionen »für Bauunternehmen attraktiver gemacht werden«, so Professor Lars Feld vom Rat der Immobilienweisen im »Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2020«.
Die Reaktionen auf Mietendeckel und Enteignungskampagne verwundern kaum, schließlich sind sie mit drastischen Einschränkungen für das bisherige Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft verbunden. Im Gegensatz zu Wohngeldzahlungen, Sozialem Wohnungsbau und moderatem Mietrecht beschränken sie tatsächlich die Ertragserwartungen oder stellen das Geschäft mit dem Wohnraum sogar vollständig in Frage. Der rhetorische Reflex, den Mietendeckel und die Enteignungsforderungen vor allem mit der DDR, dem Sozialismus oder auch Hugo Chavez zu assoziieren, zeugt von einem fest verankerten Antikommunismus in der Immobilienbranche und scheint sich des Abschreckungscharakters solcher Vergleiche sicher.
Die Kommentatoren der FAZ sind da schon einen Schritt weiter und fürchten, hinter diesen »Retro-Absurditäten« stehe ein »breiter Konsens«. Rainer Hank fabuliert von »akademischen Echokammern für die Überwindung des Kapitalismus« und einem linken Mainstream als Gefahr für die liberale Gesellschaft. Heike Göbel sieht sogar im Grundgesetz selbst einen »gefährlichen Enteignungshebel« und spricht von einem »Warnsignal für private Investoren weit über die Hauptstadt und das Land hinaus«.
Der Schock im Angesicht dieser neuen Ansätze ist nach über drei Dekaden im neoliberalen Politikmodus verständlich. Mietendeckel und Enteignungen verschieben die bisherigen Koordinaten der Wohnungspolitik. Im Rückblick auf die Geschichte der Wohnungsfrage zeigt sich jedoch schnell, dass umfassende Eingriffe durch den Staat und eine Zurückdrängung von Marktkräften keine Neuheit darstellen, sondern auch schon vor hundert Jahren auf der Agenda standen.
Kampf dem Wohnungsfeudalismus
Spätestens seit Friedrichs Engels 1872 mit seiner Streitschrift Zur Wohnungsfrage die unsozialen Auswüchse der Wohnungswirtschaft auf die ökonomischen Prinzipien des Kapitalismus zurückführte, haben sich auch in der Wohnungspolitik Positionen etabliert, die eine Antwort auf die Wohnungsfrage vor allem in der Einschränkung der Marktlogik sahen und auf eine Überwindung des Kapitalismus setzten.
Gerade weil in einer Marktökonomie der Zweck der Wohnungsbewirtschaftung nicht das Wohnen, sondern das Geschäft ist, bleiben soziale und ökologische Aspekte der Wohnversorgung systematisch auf der Strecke. David Madden und Peter Marcuse, die sich in ihrem Buch In Defense of Housing mit hundert Jahren Wohnungspolitik in Westeuropa und den USA beschäftigt haben, beschreiben eine dauerhafte Spannung zwischen der »Wohnung als Zuhause und der Wohnung als Immobilie«. Die Auflösung dieses Widerspruchs könne nur durch die Herauslösung des Wohnens aus den Verwertungslogiken erfolgen.
Schon die ersten Reformforderungen der Wohnungspolitik im 19. Jahrhundert waren auf die Einschränkung der Macht der Besitzenden oder den Bau von Wohnungen durch nicht profitorientierte Gesellschaften ausgerichtet. Insbesondere die Anfänge der Genossenschaftsbewegung und die Etablierung von Prinzipien der Gemeinnützigkeit basierten auf der Grundidee, dass eine Versorgung der Armen mit Wohnraum nur gelingen kann, wenn sie nicht von unternehmerischem Kalkül bestimmt wird. Selbst bürgerliche Philanthropen forderten aus Angst vor Seuchen und Revolten zur Mäßigung des Gewinnstrebens auf. In seinem Mahnruf in der Wohnungsfrage von 1892 rief der Ökonom und Mitbegründer des »Vereins für Socialpolitik« Gustav Schmoller »die Besitzenden und Gebildeten« dazu auf, gemeinnützige Aktiengesellschaften und Stiftungen für den Wohnungsbau zu gründen, um »der Privatbauspekulation Konkurrenz zu machen«.
Da Wohnungsbau und Vermietungsgewerbe im 19. Jahrhundert so gut wie keine Regulierung kannten, unterlagen die Wohnverhältnisse der Vertragsfreiheit und wurden von den Besitzenden diktiert. Ernst Engel – der Leiter der Preußischen Statistischen Bureaus – bezeichnete die damalige Situation wegen der Willkür der Eigentümerinnen und Eigentümer als »Wohnungsfeudalismus«. Mieterinteressen artikulierten sich in dieser Zeit vor allem in Form von Straßenprotest. So war das schnelle Wachstum der Stadt und die Entstehung der dicht besiedelten Arbeiterviertel in Berlin seit den 1860er Jahren von regelmäßigen Auseinandersetzungen zwischen Mieterinnen und Mietern auf der einen Seite und den Besitzenden auf der anderen Seite geprägt. Vor allem Exmittierungen – wie Wohnungsräumungen damals genannt wurden – gerieten mehrfach zu regelrechten Straßenschlachten, weil sich Nachbarinnen und Nachbarn versammelten, um die Räumung zu verhindern.
Der Historiker Axel Weipert hat die sogenannten »Blumenstraßenkrawalle« im Jahr 1872 als einen Höhepunkt dieser Konflikte beschrieben. Damals stellten sich mehrere Tausend Menschen über Tage der Räumung einer Tischlerfamilie entgegen, deren Baracken für einen Neubau abgerissen werden sollten. Über hundert verletzte Polizisten und noch weitaus mehr durch Polizeisäbel verwundete Protestierende bezeugen die Heftigkeit der Auseinandersetzungen. Parallel zu diesen Formen der Selbstverteidigung gegen die Vermieterwillkür entstanden die ersten Mieterorganisationen für eine koordinierte Interessenvertretung. So gründete sich 1888 mit dem kleinbürgerlich geprägten »Verein der Berliner Wohnungsmiether« der erste Mieterverein, dessen Aufgabe vor allem in der Rechtsberatung bestand. Die Forderung nach einem allgemeinen Mietrecht blieb lange ungehört und wurde erst 1923 mit dem Beschluss der Reichsmietengesetze erfüllt.
Die Zeit der Weimarer Republik war von weitgehenden staatlichen Eingriffe in den Wohnungssektor geprägt. Ihr Ziel war es, die Wohnungsnot der Nachkriegszeit zu beheben und das in der Weimarer Verfassung verankerte Recht auf Wohnen umzusetzen, das allen Menschen »eine gesunde Wohnung« und »allen Familien eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte« versprach. Eine angemessene Wohnversorgung wurde zum gesellschaftlichen Ziel erhoben und als öffentliche Aufgabe verstanden.
Mit dem Wohnraummangelgesetz von 1920, dem Reichsmietengesetz von 1922 und dem Mieterschutzgesetz von 1923 wurde die Bewirtschaftung von Wohnungen bis hin zur Festlegung der Miethöhe und der Belegung einer öffentlichen Kontrolle unterworfen. Zudem wurde mit der Einführung der Hauszinssteuer im Jahr 1924 eine dauerhafte Finanzierungsquelle für den geförderten Wohnungsbau geschaffen. Dabei wurden in den überwiegend entschuldeten Gebäuden, die vor 1918 errichtet worden waren, bis zu 40 Prozent der staatlich festgesetzten Miete als Steuer einbehalten, um den allgemeinen Finanzbedarf der Länder und Gemeinden zu decken und insbesondere die Wohnraumförderung zu finanzieren. Unter der Ägide der Hauszinssteuer wurden zwischen 1924 und 1932 mit 1,8 Millionen geförderten Wohnungen über 80 Prozent des gesamten Neubauvolumens öffentlich finanziert.
Schöner Wohnen in Ost und West
Die staatlichen Eingriffe setzten sich auch nach 1945 in wesentlichen Zügen fort. In der DDR wurde ein staatliches Bau- und Wohnungswesen etabliert, in dem die Wohnraumvergabe über die kommunalen Wohnungsverwaltungen organisiert wurde. Mit dem in der Verfassung verankerten Recht auf Wohnen und einer restriktiven Mietbegrenzung war die DDR von sozial sicheren Wohnverhältnissen geprägt. Räumungen waren nur bei Zuweisung anderer Wohngelegenheiten möglich und die Mietbelastung lag in den 1980er Jahren bei etwa 5 Prozent der durchschnittlichen Einkommen. Der Sozialwissenschaftler Jan Wielgohs kommt im Rückblick zu der Einschätzung, dass »Mietpreispolitik und Mietrecht in der DDR einseitig mieterfreundlich gestaltet« waren. Dem stand jedoch ein bis zum Schluss nicht behobener Wohnungsmangel gegenüber. Weil insbesondere die Altbauten vernachlässigt wurden und vielerorts verfielen, reichten auch die umfangreichen Neubauprogramme nicht aus, um alle Haushalte mit angemessenen Wohnungen zu versorgen.
In Westdeutschland wiederum kamen Instrumente der Wohnungszwangsbewirtschaftung, des Sozialen Wohnungsbaus und der Wohnungsgemeinnützigkeit zum Einsatz. Eingebettet in die Idee der Sozialen Marktwirtschaft wurden zwischen 1950 und 1990 fast 7,9 Millionen Wohnungen gefördert, um möglichst vielen Menschen wohnungsbezogene Wohlstandseffekte zu verschaffen. Auch ohne ein grundgesetzlich verankertes Recht auf Wohnen orientierte sich die Wohnungspolitik der Bundesrepublik in ihren ersten Jahren an der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Als Sozialer Wohnungsbau galten nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz von 1956 »Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und Miete oder Belastung für die breiten Schichten des Volkes bestimmt und geeignet sind«.
Erst mit der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit im Jahr 1989 verabschiedete sich die Wohnungspolitik der BRD vom Anspruch öffentlicher Verantwortung für die allgemeine Wohnungsversorgung. Nach der Einführung des Wohnraumfördergesetzes (WoFG) im Jahr 2001 beschränkte sich der Soziale Wohnungsbau ganz im Geiste des Marktvorrangs auf die Förderung für »Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind«.
Die Vorstellung, dass die Wohnungsversorgung vorrangig über den Markt geregelt werden soll, ist historisch relativ jung. Trotzdem wird sie in vielen aktuellen Debatten als alternativlos dargestellt. Insbesondere die Wohnungspolitik in der Zwischenkriegszeit und in der Bundesrepublik bis 1989 zeigen, dass staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt nicht zwangsläufig eine sozialistische Programmatik haben müssen.
Pragmatische Eingriffe und transformative Ansätze
Die Wohnpolitik ist ein umkämpftes Feld, in dem seit über hundert Jahren verschiedene Ansätze miteinander konkurrieren. Schon in den ersten wohnungspolitischen Debatten standen sich technokratische, reformistische und sozialistische Positionen gegenüber. Technokratische Vorschläge zur Lösung der Wohnungsfrage sind meist pragmatisch auf Veränderungen bei der Organisation von Wohnungsversorgung und Stadtentwicklung ausgerichtet, ohne den Markt und die Konkurrenz selbst infrage zu stellen. Dazu gehören Forderungen nach baurechtlichen Vorgaben und mietrechtlichen Regulierungen, um einen minimalen Wohnstandard zu sichern und die Unsicherheit der Wohnverhältnisse zu mildern. Als Dauerbrenner unter den marktkonformen Forderungen von Wohnungswirtschaft und konservativen Parteien haben sich sogenannte Subjektförderungen wie Wohngeld oder Baugeld erwiesen. Dabei sollen öffentliche Leistungen die Mietzahlungsfähigkeit oder auch die Kaufkraft erhöhen, sodass auch Haushalte mit geringeren Einkommen in die Lage versetzt werden, einen Marktpreis zu zahlen.
Reformistische Ansätze reflektieren die soziale Blindheit des Marktes und zielen auf die Einschränkung des Verwertungsdrangs sowie auf den Ausbau von nicht profitorientierten Wohnungsangeboten, ohne jedoch die Warenlogik des Wohnungsmarktes aufzuheben. Reformvorschläge reichten in der Vergangenheit vom staatlich initiierten Ausbau der Verkehrswege, um durch die Ausweitung des Angebots den Anstieg der Baugrundstückspreise abzumildern, über einen öffentlichen Beamtenwohnungsbau auf billigem Gemeindebauland bis hin zur Gründung von Genossenschaften.
»Neben der massiven Einschränkung von Mieterhöhungsmöglichkeiten, wie der Mietendeckel sie begonnen hat, und der Überführung von Wohnungsbeständen in öffentliche Verwaltung, wie die Enteignungskampagne sie fordert, müssen die nächsten Schritte auf diesem Weg auch eine Ausweitung des kommunalen Neubaus beinhalten.«
In diese Reihe der Reforminstrumente zählen auch die Förderprogramme des Sozialen Wohnungsbaus, welche durch die Übernahme von Bau- oder Finanzierungskosten die Mieten drücken konnten. Diese staatliche Übernahme der »unrentierlichen Kosten« sicherte die Wirtschaftlichkeit des Sozialen Wohnungsbaus auch für private Unternehmen, denen der Staat über die Förderverträge eine fixe Eigenkapitalverzinsung von bis zu 6,5 Prozent garantierte. Das Problem der bisherigen Förderprogramme sind allerdings die befristeten Laufzeiten der Mietpreisbindungen: Nach Ablauf der vereinbarten Förderzeiträume – von meist zwanzig bis dreißig Jahren – löst sich der Status der Sozialwohnungen auf und die ehemals geförderten Wohnungen können nach Marktkriterien verwertet werden. Seit den 1950er Jahren vertraten alle Regierungen in der BRD die Ansicht, dass soziale Wohnungsbauprogramme nur eine vorübergehende Intervention sein sollen, bis der Markt die Wohnungsversorgung wieder selbst regeln kann.
Transformative Ansätze der Wohnungspolitik setzen meist auf Umverteilung und die Überwindung der Warencharakters von Wohnraum. Der Grundgedanke dabei ist, die Entfremdung des Wohnens aufzuheben, die sich aus der Abhängigkeit von privaten Eigentümerinnen und Eigentümern sowie ihren wirtschaftlichen Kalkulationen ergeben. Deshalb zielen die meisten transformativen Eingriffe auf die Ausweitung von kollektiven und gesellschaftlichen Eigentumsstrukturen im Wohnungsbereich. Dazu zählen erstens selbstverwaltete Genossenschaften und Hausprojekte, die dem Interesse ihrer Mitglieder verpflichtet sind, zweitens gemeinnützige Wohnungsunternehmen mit einem dauerhaften sozialen Versorgungsauftrag und drittens öffentliche Wohnungsunternehmen. Alle drei Eigentumsformen richten ihre Bewirtschaftung nicht an der Erzielung von Gewinnen, sondern an wohnungsbezogenen Versorgungszielen aus.
In der Geschichte waren es vor allem die Förderprogramme für öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen in den 1920er Jahren, der Soziale Wohnungsbau durch gemeinnützige Unternehmen in der BRD und der staatliche Wohnungsbau in der DDR, die den Anteil des Wohnungsbestands erhöhen sollten, der dauerhaft dem Markt entzogen ist und den Kreislauf der Verwertung durchbricht.
Was macht eine Wohnungspolitik »sozialistisch«?
Friedrich Engels schrieb im Jahr 1872: »Um dieser Wohnungsnot ein Ende zu machen, gibt es nur ein Mittel: die Ausbeutung und Unterdrückung der arbeitenden Klasse durch die herrschende Klasse überhaupt zu beseitigen.« Damit erteilte er im Grunde allen Reformvorschlägen in der Wohnungspolitik eine Abfuhr – denn ohne eine Aufhebung des Kapitalismus sei eine Lösung der Wohnungsfrage nicht zu haben. Indem Engels die Wohnungsnot als ein Ergebnis der privaten Eigentumsverhältnisse und der wirtschaftlichen Gewinnlogik des Kapitals analysierte, lieferte er zugleich einen Ansatz zu ihrer Überwindung. Sozialistische Vorschläge für die Lösung der Wohnungsfrage richteten sich seither auf die Veränderung der Eigentumsverhältnisse und die Überwindung von Marktlogiken.
In der Geschichte setzten linke Parteien meist auf eine Verstaatlichung des Wohnungssektors. Doch eine staatlich organisierte Wohnungspolitik hat mindestens drei Schwachstellen: den Paternalismus, die Standardisierung und die Abhängigkeit von politischen Konjunkturen. Die meisten staatlichen Eingriffe und Wohnungsbauprogramme werden durch bürokratische Regeln und Vorgaben implementiert und grenzen die Entfaltungsmöglichkeiten einzelner gesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure ein. Sie beschränken damit oftmals auch die Initiative der Einzelnen, für die Gestaltung ihrer individuellen Wohnbedingungen Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere die klimapolitischen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, sind jedoch nur mit einer tatsächlichen Veränderung von Lebensweisen und Wohnformen zu bewältigen, die eine aktive Beteiligung von möglichst vielen voraussetzt. Um diese Schwächen einer Verstaatlichung zu vermeiden, betonen die städtischen Protestbewegungen seit den 1970er Jahren verstärkt die Elemente von Selbstverwaltung und Mitbestimmung im Bereich des Wohnens. Insbesondere in den Hochphasen der Hausbesetzungen und in den vielen selbstorgansierten Wohnprojekten entwickelten die Aktiven neue Formen der kollektiven Verantwortung und Bewirtschaftung. Sie blieben jedoch als Praxis einer Subkultur zumindest in Deutschland eine gesellschaftliche Nischenerscheinung.
Erst mit den jüngsten Wohnungskrisen und mietenpolitischen Bewegungen kommt neuer Schwung in die Debatten über Selbstverwaltung. Gerade weil es viele Hausgemeinschaften sind, die sich zu Mikrokollektiven zusammenschließen, um die nächste Mietsteigerung, die Umwandlung in Eigentumswohnungen oder die Modernisierungsmaßnahmen zu verhindern, die sie aus ihren Häusern verdrängen würden, erhält der Wunsch nach einer gemeinschaftlichen Kontrolle über die eigenen Wohnverhältnisse eine neue soziale Basis.
Eine Überwindung von Ungleichheit, Entfremdung und Ressourcenverschwendung im Bereich des Wohnens setzt eine umfassende Transformation des Wohnungswesens voraus. Die Kernelemente einer zeitgemäßen sozialistischen Wohnungspolitik lassen sich als ein Dreiklang aus öffentlicher Verantwortung für die Wohnversorgung, einer Sozialisierung möglichst großer Segmente des Wohnungsmarktes und dem Ausbau der Kontroll- und Mitbestimmungsmöglichkeiten durch die Bewohnerinnen und Bewohner beschreiben.
Neben der massiven Einschränkung von Mieterhöhungsmöglichkeiten, wie der Mietendeckel sie begonnen hat, und der Überführung von Wohnungsbeständen in öffentliche Verwaltung, wie die Enteignungskampagne sie fordert, müssen die nächsten Schritte auf diesem Weg auch eine Ausweitung des kommunalen Neubaus beinhalten. Wenn Wohnen nicht als Wirtschaftsgut, sondern als soziale Infrastruktur verstanden werden soll, müssen Voraussetzungen und Strukturen für einen neuen kommunalen Wohnungsbau entwickelt und durchgesetzt werden. Der Blick in die Geschichte zeigt: Eine öffentliche Verwaltung des Wohnungswesens und auch umfangreiche Neubauprogramme jenseits der Marktlogik sind möglich. Diese Ansätze erfolgreich in die Gegenwart zu übersetzen und neue Strategien für eine Organisation des Wohnens in öffentlicher Verantwortung zu entwickeln, ist der Maßstab jeder linken Wohnungspolitik.
Andrej Holm ist Soziologe und Aktivist. Er arbeitet und forscht zu den Themen: Stadtplanung und Wohnungspolitik.