20. Mai 2020
Welche linke Strategie brauchen wir in der Corona-Krise?
Alles ist anders durch Corona – auch für linke Politik. Keine Demos, keine Podiumsdiskussionen, Solikonzerte oder Flyeraktionen. Strategien, die ohnehin nie wirklich welche waren. Was wir jetzt tun müssen, um zu gewinnen.
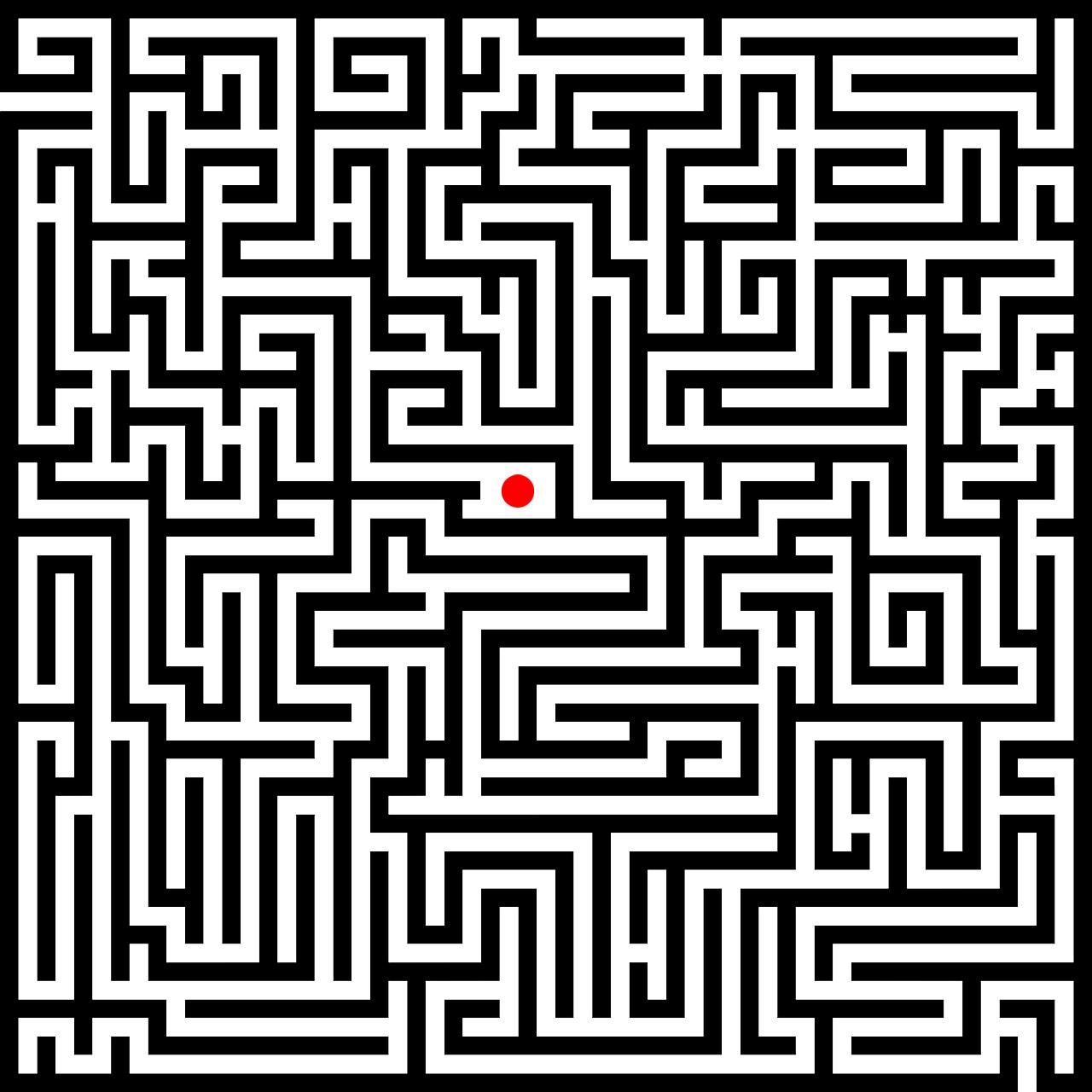
Krisen – wirkliche Krisen und nicht nur der normale Wirtschaftsabschwung – sind geprägt von der Unsicherheit, die sie mit sich bringen. Sie unterbrechen die Normalität und verlangen nach noch zu findenden Antworten. Inmitten dieser periodischen Katastrophen wissen wir nicht, wie und ob wir überhaupt einen Ausweg finden werden. Oder was wir zu erwarten haben, wenn sie enden. Deshalb sind Krisen Unruhemomente, die neue politische Entwicklungen ermöglichen, im Guten wie im Schlechten.
Weil jede solcher Krisen die Richtung der Geschichte verändert, vollzieht sich jede darauffolgende Krise in einem veränderten Kontext und weist ihre eigenen, sie definierenden Merkmale auf. Zur Krise der 1970er gehörte beispielsweise eine kämpferische Arbeiterinnenklasse und die Infragestellung des amerikanischen Dollar. Sie beschleunigte die Globalisierung und stärkte die Rolle des Finanzkapitals.
Zur Krise von 2008-9 hingegen gehörte eine größtenteils besiegte arbeitende Klasse. Sie untermauerte die zentrale globale Rolle des Dollar und schuf neue Verwaltungsformen einer spezifisch finanzgestützten Wirtschaft. Wie die Krise zuvor führte auch die Krise von 2008-9 zur weiteren neoliberalen Finanzialisierung, doch diesmal öffnete sie zugleich dem rechten Populismus Tür und Tor und desorientierte die traditionellen politischen Parteien enorm.
Die aktuelle Krise: Gesundheit versus Wirtschaft
Die aktuelle Krise zeichnet sich dadurch aus, dass sie alles auf den Kopf stellt. Die Welt wird, wie Alice im Wunderland es ausdrücken würde, immer »seltsamer und seltsamer«. In vorigen Krisen intervenierte der Staat, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Diesmal liegt der unmittelbare Fokus der Staaten nicht darauf, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sondern vielmehr darin, sie weiter zu beschränken.
Dies liegt augenscheinlich daran, dass die Wirtschaft nicht von wirtschaftlichen Faktoren oder Kämpfen von unten in die Knie gezwungen wurde, sondern durch einen mysteriösen Virus. Oberste Priorität ist es, dessen Kontrolle über unser Leben zu beenden. Mit der sprachlichen Begegnung des Virus mit Wörtern wie »Social Distancing« und »Selbstisolation«, haben Regierungen jene soziale Interaktionen unterbrochen, die einen Großteil der Welt der Arbeit und des Konsums ausmachen: Die Wirtschaftswelt ist angehalten.
Die Konzentration auf Gesundheit, während zugleich die Wirtschaft in den Hintergrund tritt, ist eine bemerkenswerte Kehrtwende im politischen Diskurs. Noch vor wenigen Monaten wollte der französische Präsident und Unternehmensliebling Emmanuel Macron den Wohlfahrtsstaat massiv schwächen. Er verkündete, Frankreich würde eine unternehmensfreundliche Nation werden, die »denkt und handelt wie ein Start-Up«. Jetzt erklärt er mit ernster Miene: »freie Gesundheitsversorgung […] und der Wohlfahrtsstaat sind wertvolle Ressourcen und unerlässliche Vorteile, wenn das Schicksal zuschlägt.«
Mit seiner 180-Grad-Wende ist Macron nicht allein. Politikerinnen und Politiker aller Parteien sprechen davon, die Produktion auf die sozial notwendigen Konsumgegenstände zu limitieren: Beatmungsgeräte, Krankenhausbetten, Schutzmasken und Handschuhe.
Plötzlich ist es ganz normal, Unternehmen vorzuschreiben, was sie zu produzieren haben. Der konservative Premierminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson, fordert Automobilunternehmen dazu auf, »statt Autos, Beatmungsgeräte zu produzieren«. US-Präsident Donald Trump geht erstaunlicherweise sogar noch weiter, indem er General Motors im Rahmen des Defense Production Act »befiehlt«, Beatmungsgeräte zu produzieren. In dieser neuen Welt scheint fast vergessen zu sein, dass das, was die politischen Führungskräfte jetzt erwägen, noch letztes Jahr völlig ignoriert oder höhnisch abgelehnt wurde (nicht nur von Politikerinnen und Politikern, selbst von zentralen Gewerkschaftsführern).
»Verlässlich in seiner Unzuverlässigkeit änderte Trump seine Meinung innerhalb kürzester Zeit erneut – bestärkt durch den Aktienmarkt, Fox News und Wirtschaftsbosse.«
Gleichzeitig hat die Krise denjenigen, die zuvor weggeschaut haben, vor Augen geführt, dass das Einkommen von Arbeiterinnenhaushalten extrem fragil ist. Jetzt, wo so vielen Menschen empfindlicher Mangel und soziales Chaos droht, müssen Regierungen auf allen Ebenen die grundlegenden medizinischen und überlebensnotwendigen Bedürfnisse der Menschen anerkennen.
Abgeordnete der Demokraten schlagen gemeinsam mit denen der Republikaner Gesetze vor, die Hypothekenzahlungen aussetzen, Mietregulierung verschärfen und Zinszahlungen auf Universitätsschulden streichen. Uneins sind sie weniger darüber, ob Arbeiterinnen und Arbeiter, die dazu gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, mehr Geld bekommen sollten oder ob das Krankheits- und Arbeitslosengeld erhöht werden müsste, sondern vor allem wie hoch diese Unterstützungen sein sollte.
Während der Großen Depression kam es zu einer ähnlichen politischen Kräfteverschiebung, die Sozialprogramme und Arbeitnehmerrechte bestärkte. Doch diese Entwicklung war ein Zugeständnis gegenüber den Massenmobilisierungen der damaligen Zeit; diesmal handelt es sich um eine Reaktion auf die Verbreitung der Pandemie und auf die Notwendigkeit, Menschen von ihrer Arbeit fern zu halten.
Damit ist nicht gemeint, dass »die Wirtschaft« ignoriert wird, sondern nur, dass die gewöhnliche Priorität gegenüber dem Sozialen, das heißt der gesundheitlichen Bedrohung, in den Hintergrund tritt. Es bleibt die tiefgehende und gemeinschaftliche Sorge, dass genug der wirtschaftlichen Infrastruktur erhalten bleibt (Produktion, Dienstleistung, Handel, Finanzen), um damit »später« zu so etwas wie Normalität zurückkehren zu können. Daher auch die enormen Rettungspaketen, die diesmal – im Gegensatz zur Krise 2008-9 – nicht nur den Banken zu Gute kommen, sondern auch z.B. dem Flugverkehr, Hotels und Restaurants sowie in besonderem Maße auch kleinen und mittleren Unternehmen.
Trump dachte vor allem an die Wirtschaft, als er auf die sich anbahnende Gesundheitskrise reagierte. Ein aufgebrachter Wissenschaftler kommentierte daraufhin, dass »wenn Marsianer die Erde überfallen würden, unsere erste Antwort eine Senkung des Leitzins wäre«. Nachdem er von seinen Beratern überzeugt wurde, dass das allein nicht ausreichen würde, erschien ein ernsthafterer Donald Trump auf unseren Bildschirmen und wurde für sein regelrecht präsidentielles und bestimmtes Handeln hoch gelobt.
Bis vor Kurzem war das Establishment der Demokratischen Partei darauf konzentriert, Bernie Sanders zu besiegen. Sie fürchteten, dass Trump Sanders’ Radikalismus bei den Wahlen für sich nutzen würde, aber auch die Konsequenzen eines Sanders-Sieges auf ihre eigene Partei. Nun erlebten sie ein weiteres Horrorszenario: Was, wenn Trumps Notmaßnahmen die Demokraten von links überholen würden? »Oben ist unten, Norden ist Süden«, kommentierte ein Insider der Demokratischen Partei sarkastisch.
Verlässlich in seiner Unzuverlässigkeit änderte Trump seine Meinung innerhalb kürzester Zeit erneut – aufgrund seines wirtschaftlichen und populistischen Instinkts – und bestärkt durch den Aktienmarkt, Fox News und Wirtschaftsbosse. Der Lockdown, verkündete er, wäre eine Frage von »Tagen, nicht Wochen oder Monaten«. Diese undurchdachte Verlautbarung konnte angesichts der wachsenden Sterberaten und der überfüllten Krankenhäuser nicht aufrechterhalten werden. Erneut wurden wir daran erinnert – und sicher nicht zum letzten Mal – dass Trump, aufgrund von Amerikas Status in der Welt, nicht nur einer der mächtigsten, sondern auch einer der gefährlichsten Anführer der Welt ist.
Widersprüche des Gelddruckens
Weltweit haben Regierungen auf magische Weise einen Weg gefunden, scheinbar grenzenlos Hilfsprogramme und Rettungsschirme aller Art aufzusetzen, die vorher unmöglich schienen. Doch auch wenn man die Frage beiseite lässt, ob angesichts jahrelanger Infrastrukturkürzungen die Abwicklung dieser Programme verwaltungstechnisch möglich ist, muss man doch in Frage stellen, ob das alles wirklich dadurch bezahlt werden kann, dass man einfach immer mehr Geld druckt.
Die weitverbreitete Kritik ist, dass in Wirtschaften mit (annähernder) Vollbeschäftigung solch riesige Geldeinspritzungen inflationär wirken könnten. Zwar wird es Engpässe und Inflation in einigen Sektoren geben, doch im gegenwärtigen Status quo – in dem Kapital in einem rekordhaften Ausmaß untätig ist – können Inflationssorgen ignoriert werden. Indem die Pandemie jedes Land zu den gleichen Maßnahmen zwingt, wird der übliche Disziplinierungsmechanismus der Kapitalflucht unwirksam – es gibt keinen Ort, an den man fliehen könnte. Dennoch gibt es Widersprüche, die allerdings in unserer gegenwärtigen Situation eine andere Form annehmen.
Zunächst einmal gibt es nichts umsonst. Wenn die Krise vorbei ist, müssen die Notfall-Ausgaben irgendwie bezahlt werden. Dies wird in einem Kontext erhöhter Erwartungen geschehen, da Menschen die Realisierbarkeit jener Programme erlebt haben, die zuvor noch als unmöglich deklariert wurden. Wie es Vijay Prashad trotzig ausdrückte: »Wir werden nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war das Problem.«
Wenn die Wirtschaft wieder voll angelaufen ist, können die neuen Erwartungen der arbeitenden Klasse nicht mit dem Anwerfen der Gelddruckereien befriedigt werden. Denn Arbeitskraft und natürliche Ressourcen sind begrenzt und wir werden uns entscheiden müssen, wer was bekommt; Fragen der Ungleichheit und Umverteilung werden sich verstärkt stellen – darauf deutet der Verlauf der Geschichte vor und während der Krise hin.
Zweitens wird dies, mit dem Rückzug der Krise, ungleichmäßig geschehen. Wenn das Kapital erneut zu fließen beginnt, wird es aus den Ländern rausfließen, die weiterhin mit den Problemen der Pandemie zu kämpfen haben. Dies wird fundamentale moralische Fragen zu Kapitalströmen aufwerfen. Und selbst wenn erst einmal alle Länder der Pandemie entkommen sind, werden sie zwar eifrig versuchen, das Ganze hinter sich zu lassen, aber wenn damit auch die Finanz-»Disziplin« zurückkehrt, werden es einige Menschen sicher nicht allzu wohlgesonnen aufnehmen, dass die wirtschaftliche Erholung und Entwicklung durch eigennützige Kapitalströme untergraben wird. Insbesondere nicht nach dem zweiten Rettungsschirm innerhalb von zwölf Jahren, für dessen Kosten schlussendlich der Rest von uns aufkommen musste.
Die Annahme, dass Finanzmärkte unantastbar seien, scheint dahin; man könnte auf die Idee kommen, wie Alice zu denken, »es sei fast nichts unmöglich«. Zur Rebellion gegen die Ungleichheit könnten dann die Forderungen nach Finanzmarktregulierungen hinzukommen.
Zwar stimmt es, dass die globale Rolle des US-Dollar den USA eine gewisse Sonderrolle erlauben, da in Zeiten der Unsicherheit es gemeinhin zu einer verstärkten Nachfrage kommt – selbst wenn die Quelle der Unsicherheit Ereignisse in den USA selbst sind, wie die Hypothekenkrise von 2007-9. Aber auch das hat seine Grenzen.
So könnte ein weiterer Anstieg des US-Wechselkurses US-Güter weniger wettbewerbsfähig machen und damit die Produktion in den USA weiter schwächen. Wichtiger noch: das internationale Vertrauen in den Dollar basierte nicht nur auf der Stärke der US-Finanzmärkte, sondern war stets auch davon abhängig, dass die USA ein sicherer Zufluchtsort waren, dessen arbeitenden Klassen wirtschaftlich und politisch fügsam war.
Sollten diese Arbeiterinnen und Arbeiter rebellieren, wäre der Dollar ein weitaus unsicherer Zufluchtsort. Umfang und Ziel der Kapitalströme könnte dadurch problematischer werden, selbst für die Vereinigten Staaten (und auch wenn am Ende nicht eine neue Währung den Dollar als globalen Standard ersetzen würde, so könnte dies doch zu einem erheblichen innenpolitischen und internationalen Finanzchaos führen).
Möglichkeiten für die Linke?
Wir wissen nicht, wie lange die Krise anhalten wird; vieles hängt von dieser Unklarheit ab. Wir können auch nicht guten Gewissens einschätzen, wie dieser unvorhersehbare und fließende Moment unsere Gesellschaft beeinflussen und unsere Vorstellungen vom »Normalzustand« verändern wird. In solch unsicheren und besorgniserregenden Zeiten sehnen sich die meisten Menschen nach einer schnellen Rückkehr zur Normalität, selbst wenn das, was vorher normal war, zahllose Frustrationsmomente mit sich brachte. Solche Neigungen gehen meist einher mit Autoritätshörigkeit, da diese uns durch die Katastrophe zu führen verspricht; und lässt eine neue Welle von staatlichem Autoritarismus befürchten.
Wir sollten natürlich niemals die Gefahr von rechts unterschätzen. Und wer weiß, welche Dynamik die Krise entfalten kann, wenn sie über den Sommer anhält. Doch die Umrisse dieser Krise zeichnen eine andere Möglichkeit auf: eine gewisse Empfänglichkeit, oder besser gesagt größere Möglichkeiten und Chancen, für die politische Linke. Den oben genannten Beispielen liegt die Tatsache zugrunde, dass zumindest derzeit die Märkte in den Hintergrund treten. Die Dringlichkeit, mit der wir Arbeit, Ressourcen und Schutzausrüstung verteilen, hat Wettbewerbsfähigkeit und Profitmaximierung verdrängt. Stattdessen genießt Jenes Priorität, was sozial notwendig ist.
Zusätzlich segelt das Finanzsystem erneut in unbekannte Gewässer und darf auf einem weiteren grenzenlosen Rettungsschirm durch Zentralbanken und Staaten hoffen. Die aufgebrachte Bevölkerung könnte, wie gesagt – sollte sie zusehen müssen, wie sich die Geschichte wiederholt – weniger passiv reagieren als noch vor zwölf Jahren. Zweifellos werden die Menschen erneut ihre unmittelbare Abhängigkeit von der Rettung der Banken hinnehmen – wenn auch widerwillig – doch Politikerinnen und Politiker werden sich um ein öffentliches Aufbegehren sorgen müssen, sollte der Finanzindustrie auch dieses Mal keine angemessene Gegenleistung aufgezwungen wird.
Zusätzlich könnte es zu kulturellen Verschiebungen kommen, die aktuell noch nicht abschätzbar sind. Die Natur der Krise und die sozialen Beschränkungen, die zu ihrer Überwindung notwendig sind, haben Zusammenarbeit und Solidarität zur Tagesordnung gemacht – im Gegensatz zu sonst gängigem Individualismus und neoliberaler Gier. Ein unauslöschliches Bild aus dieser Krise sind die eingesperrten und zugleich erfinderischen Italienerinnen, Spanier und Portugiesinnen, die gemeinsam auf den Balkonen singen, jubeln und klatschen: für den Mut des Pflegepersonals, das an der Front im globalen Krieg gegen das Coronavirus oft schlecht bezahlt wird und zugleich die wichtigste Arbeit leistet.
Während sich die Krise und die staatlichen Gegenmaßnahmen entfalten, eröffnet all dies die Möglichkeit – aber auch nur die Möglichkeit – einer Neuausrichtung der gesellschaftlichen Perspektive. Alles, was vormals »natürlich« schien, ist nun anfällig geworden. Anfällig gegenüber Fragen danach, wie wir leben und miteinander in Beziehung stehen sollten.
Für die wirtschaftlichen und politischen Eliten birgt dies natürlich Gefahren. Ihre Aufgabe ist es, sicherzugehen, dass die Maßnahmen, die jetzt unvermeidlich und deren schlussendliche Resultate unvorhersehbar sind, in ihrer Dauer und Reichweite begrenzt bleiben. Sobald die Krise sicher überstanden ist, müssen die unbequemen Ideen und riskanten Schritte wieder zurück in die Kiste gepackt und diese fest verschlossen werden.
Für die progressiven Kräfte in der Bevölkerung hingegen besteht die Herausforderung darin, die vielversprechenden ideologischen Chancen auszunutzen, damit die Kiste geöffnet bleibt. Die positiven, gar radikalen politischen Maßnahmen müssten ausgenutzt und aus den verschiedenen kreativen Aktionen, die vielerorts vollzogen wurden, gelernt werden.
Jeder nach seinen finanziellen Möglichkeiten, jede nach ihren Bedürfnissen
Der offensichtlichste ideologische Wandel, den die Krise mit sich gebracht hat, ist bei den Einstellungen gegenüber dem Gesundheitsweisen zu beobachten. Heute scheint es in den USA noch weltfremder als schon zuvor, ein öffentliches Gesundheitssystem abzulehnen. Auch diejenigen, die zwar ein öffentliches Gesundheitswesen dulden, zugleich aber fest entschlossen sind, Kürzungen durchzusetzen, die das Gesundheitssystem überlasten würden, ebenso wie diejenigen, die das Gesundheitssystem nur als Ware verstehen, die nach wirtschaftlichen, profitorientierten Kriterien verwaltet werden soll, befinden sich merkwürdigerweise auf dem Rückzug. Es hat sich ganz offen gezeigt, wie gefährlich unvorbereitet uns die von ihnen angestrebte gesellschaftliche Grundstruktur gegenüber Notfällen gelassen hat.
Während wir versuchen, die neue Stimmung zu festigen, sollten wir uns nicht mit diesen defensiven Spielchen zufriedengeben. Wir sollten jetzt ehrgeiziger denken und auf eine weitaus umfassenden Vorstellung von »Gesundheitsvorsorge« bestehen. Angefangen mit schon lange bestehenden Forderungen, Zahn- und Augenversorgung sowie Medikamente in die öffentliche Gesundheitsprogramme aufzunehmen. Das würde die Einrichtungen für langfristige Pflege, insbesondere die privaten Anbieter, aber auch die öffentlichen, auf ein angemessenes Niveau bringen. Es stellt sich die Frage, wieso ausgerechnet das Pflegepersonal, das sich um die Kranken, Invaliden und Alten kümmert, nicht Teil eines öffentlichen Gesundheitssystems, gewerkschaftlich organisiert und wird entsprechend behandelt wird. Angesichts des Mangels an unentbehrlicher medizinischer Ausstattung, steht außerdem zur Debatte, ob nicht das gesamte Gesundheitswesen, einschließlich der Hersteller von Pflegeausrüstung, in öffentliches Eigentum übergehen sollte. So könnte angemessen für gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse geplant werden.
Größer zu denken heißt auch, sich die Verbindung zwischen Gesundheit und Ernährung bewusst zu machen; es heißt, sich den Problemen der Wohnungspolitik und dem Widerspruch zwischen »Social Distancing« und überfüllter Obdachloseneinrichtungen anzunehmen; es heißt, Kinderversorgung zu gewährleisten; sowie auch, die temporär zugestandenen Krankheitstage als Normalzustand zu etablieren. Schließlich hieße es, »Universalität« wirklich ernst nehmen und auch Migrantinnen und Migranten, die tagtäglich auf unseren Feldern arbeiten, und den Geflüchteten, die dazu gezwungen wurden, ihre Communitys zu verlassen (oftmals ein Ergebnis jener internationalen Politik, die von unseren Regierungen gebilligt wurden) mitzudenken.
Ganz grundsätzlich wäre der Sieg des Gesundheitsvorsorge-Prinzips »Jeder nach seinen finanziellen Möglichkeiten, jede nach ihren Bedürfnissen« ein inspirierender und strategischer Impuls, um das grundlegende Prinzip der verstaatlichten Gesundheitsvorsorge auf die restliche Wirtschaft auszuweiten.
»Die Versorgung mit Medikamenten und Impfstoffen ist zu wichtig ist, um sie privaten Unternehmen mit ihren privaten Prioritäten zu überlassen.«
Die existentielle Notwendigkeit, Gegenmittel für die Pandemien zu finden, bürdet den Pharmakonzernen eine besondere Verantwortung auf. Sie haben versagt. Bill Gates, Mitgründer von Microsoft und mit finanziellen Entscheidungen nicht unvertraut, erklärt dieses Versagen damit, dass Pandemieprodukte »außerordentlich risikoreiche Investitionen« darstellten – ein höflicher Weg zu sagen, dass Unternehmen, ohne massive staatliche Subventionen, diese Investitionen nicht angemessen tätigen werden. Der Historiker Adam Tooze drückte es noch direkter aus: Wenn es darum geht, dass Pharmaunternehmen das Soziale vor das Profitable stellen sollen, »erhalten Coronaviren nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie Erektionsstörungen«.
Der Punkt ist, dass die Versorgung mit Medikamenten und Impfstoffen zu wichtig ist, um sie privaten Unternehmen mit ihren privaten Prioritäten zu überlassen. Sollte Big Pharma die Erforschung in Zukunft benötigter Impfstoffe nur dann durchführen, wenn der Staat das Risiko trägt, die Forschung betreibt, die Herstellungskapazitäten bereitstellt und die Verteilung der Medikamente und Impfstoffe übernimmt, stellt sich natürlich die Frage, warum wir dann nicht den eigennützigen Zwischenhändler überspringen und diese Aufgaben innerhalb eines staatlichen Gesundheitssystems der öffentlichen Hand überlassen.
Die nächste Pandemie
Die mangelhafte Vorbereitung auf das Coronavirus liefert uns die klarsten und beängstigendsten Warnungen nicht nur für die nächste Pandemie, sondern auch für die andere Gefahr, die bereits über unseren Köpfen schwebt. Die drohende Umweltkrise wird nicht durch soziale Distanz oder einen Impfstoff gelöst werden. Und wie beim Coronavirus bringt auch diese Krise, je länger wir darauf warten, sie anzugehen, katastrophalere Folgen mit sich.
Doch im Gegensatz zum Coronavirus geht es bei der Umweltkrise nicht nur darum, eine temporäre Gesundheitskrise zu beenden, sondern auch darum, einen Schaden zu heilen, der bereits angerichtet wurde. Wir müssen unser gesamtes Leben verändern: wie wir arbeiten, reisen, spielen und unser soziales Miteinander gestalten. Dazu müssen wir diejenigen produktiven Fähigkeiten entwickeln und erhalten, die gebraucht werden, um die notwendigen Veränderungen in Infrastruktur, Wohnungen, Fabriken und Büros zu vollziehen.
So weitverbreitet die Idee der Transformation jetzt auch scheint, sie bleibt nichtsdestotrotz eine radikale Idee. Der gutgemeinte Slogan eines »gerechten Übergangs« klingt beruhigend, geht aber nicht weit genug. Diejenigen, die damit überzeugt werden sollen, fragen zurecht: Wer wird diese Garantie durchsetzen? Ohne umfassende Planung, wird es nicht gelingen, die Wirtschaft umzugestalten und die Umwelt vorn anzustellen. Jede Form der Planung fordert die Rechte des Privateigentums heraus, die Unternehmen derzeit genießen.
Das Mindeste wäre eine nationale Umrüstungsbehörde, die über ein Mandat verfügen müsste, die Schließung von Fabriken zu verbieten, die so umgewandelt werden können, dass diese Umwelt- oder Gesundheitsinteressen dienen könnten, und die zugleich diesen Umrüstungsprozess überwacht. Arbeitende könnten sich als Whistleblower bei dieser Behörde melden, wenn sie das Gefühl bekommen, dass ihre Fabriken geschlossen werden soll. Allein die Existenz dieser Institution würde Arbeitende ermutigen, geschlossene Fabriken zu mehr als nur Protestzwecken zu besetzen; anstatt sich an die Unternehmen, die nicht mehr am Standort interessiert sind, könnten sie sich an die Umrüstungsbehörde wenden, um diese dazu zu bewegen, von ihrem Mandat Gebrauch zu machen.
Eine solche nationale Behörde könnte mit einer nationalen Behörde für Arbeit verknüpft werden, die für Ausbildung und Umstrukturierungen verantwortlich wäre. Sie würden ergänzt werden durch regionale Technologie-Umrüstungszentren, die hunderte, gar tausende junger Ingenieure anstellen könnte, die ihre Fähigkeiten auf die existenzielle Herausforderung der Umwelt voller Enthusiasmus anwenden würden.
Lokal gewählte Umweltausschüsse würden außerdem den Zustand ihrer Community überwachen. Lokal gewählte Arbeits-Entwicklungsausschüsse würden die Bedürfnisse von Community und Umwelt mit den Fragen der Arbeit, Arbeitsplatzumrüstung und der Entwicklung von Arbeiter- und Fabrikkapazitäten zusammenbringen. All dies sollte als Teil eines nationalen Plans finanziert werden und in der aktiven Nachbarschaftscommunity und mit den Arbeitsplatzkomitees verbunden sein.
Die Banken: Gebrannte Kinder scheuen das Feuer
Jede von uns erhoffte Veränderung muss sich der Dominanz des privaten Finanzsektors in unserem Leben stellen. Das Finanzsystem hat alle Merkmale eines öffentlichen Guts: es ölt die Räder der Wirtschaft, sowohl der Produktion als auch des Konsums; es vermittelt staatliche Politik; und sobald Schwierigkeiten auftreten, wird seine Unverzichtbarkeit verlautbart. Wir haben allerdings nicht die politische Kraft oder die technische Fähigkeit, das Finanzsystem jetzt zu übernehmen und für andere Zwecke einzusetzen.
Zwei Probleme sind zentral: Zunächst muss die Frage Teil der öffentlichen Debatte werden; wenn wir sie nicht jetzt diskutieren, wird der Moment, um die Transformation durchzusetzen, niemals kommen. Zweitens müssen wir bestimmte Bereiche innerhalb des Finanzsystems etablieren, um zum einen bestimmte Vorrechte durchzusetzen, und zum anderen das Wissen und die Fähigkeiten zu entwickeln, um das Finanzsystem schlussendlich nach unseren eigenen Interessen zu gestalten.
Ein logischer Ausgangspunkt wäre der Aufbau zweier spezifischer staatlicher Banken: die eine würde notwendige Infrastrukturmaßnahmen finanzieren, die so sträflich vernachlässigt wurden; die andere würde den Green New Deal und die Umrüstung finanzieren. Sollten diese Banken um Finanzierung konkurrieren und profitabel agieren müssen, würde sich nur wenig ändern.
Wie Scott Aquanno in einer bald erscheinenden Arbeit argumentiert, müsste die politische Entscheidung, solche Banken zu entwerfen, auch durch politisch motivierte Geldströme unterstützt werden, um das zu gewährleisten, was die privaten Banken so unzureichend geleistet haben: die Investition in Projekte, die einen hohen sozialen Gegenwert haben, auch wenn sie riskant und den üblichen Maßstäben folgend nicht profitabel seien. Die Ausgangsfinanzierung könnte durch eine Abgabe aller anderen Finanzinstitutionen zustande kommen – eine Rückzahlung jener riesigen Rettungsschirme, die sie vom Staat erhalten haben. (Mit einer gesicherten Finanzierung könnten diese öffentlichen Banken auch Kredite auf dem privaten Markt aufnehmen, ohne von ihm abhängig zu sein.)
Demokratische Planung: ein Widerspruch in sich
Wenn die Linke von demokratischer Planung spricht, dann bezieht sie sich auf eine neue Art von Staat – einen, der den öffentlichen Willen ausdrückt, weitestgehende Mitsprache fördert, und der aktiv öffentliche Teilhabemöglichkeiten entwickelt. Ein Gegensatz also zu der Reduzierung von Bürgerinnen und Arbeiterinnen zu passiven Waren und Datenpunkten. Skeptiker werden spotten, doch die bemerkenswerte Erfahrung, die wir alle gerade durchmachen, zeigt, wie schnell all das, was gestern noch »offensichtlich« unmöglich war, ganz »offensichtlich« heute möglich sein kann – wir sollten diese Vision also nicht vorschnell abtun.
Menschen haben nicht vor der »Planung« an sich Angst. Schließlich planen auch Haushalte, Unternehmen und sogar neoliberale Staaten. Die üblichen Befürchtungen, Ängste und Widersprüche entstehen durch den Umfang der Planung, von der wir hier sprechen Diese Verunsicherung kann nicht einfach abgetan werden, indem die Schuld dafür Unternehmen, Medien und der Propaganda des Kalten Krieges zugeschoben wird. Das Misstrauen gegenüber mächtigen Staaten hat eine materielle Grundlage. Nicht nur in den anderenorts gescheiterten Experimenten, sondern auch im alltäglichen Umgang der Bevölkerung mit Staaten, die in der Tat häufig bürokratisch, willkürlich, verschwenderisch und distanziert sind.
Das Adjektiv »demokratisch« vorn anzustellen löst dieses Dilemma nicht. Und auch wenn internationale Beispiele möglicherweise einige Maßnahmen und Strukturen anregen, ist die bittere Wahrheit doch, dass es derzeit keine vollends überzeugenden Modelle gibt. Daher wiederholen wir gebetsmühlenartig unsere Kritik am Kapitalismus, die schlicht nicht ausreicht, so wichtig sie auch ist. Skeptikerinnen mögen nun fatalistisch entgegnen, dass alle Systeme zwangsläufig ungerecht sind, den »einfachen« Bürgerinnen gefühllos gegenüberstehen, und von und für Eliten regiert werden. Warum also unsichere Wege riskieren, um bestenfalls wieder in derselben Situation zu enden?
Was wir tun können, ist eine eindeutige Selbstverpflichtung auszusprechen, um Anderen zu versichern, dass wir keinen allmächtigen Staat befürworten und dass wir die liberalen Freiheiten wertschätzen, die in der Geschichte hart erkämpft wurden: die Ausweitung des Stimmrechts auf die Arbeiterinnen und Arbeiter, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit (einschließlich dem Gewerkschaftsrecht), Schutz vor willkürlicher Verhaftung, staatliche Transparenz. Und wir sollten betonen, dass man Einkommen und Reichtum massiv umverteilen muss, wenn man diese Rechte ernst nimmt. Nur dadurch hätte jede Person wirklich, und nicht nur formal, die Möglichkeit zur Beteiligung.
Wir sollten die Leute außerdem daran erinnern, wie weit entfernt wir von einem Kapitalismus als Welt der kleinen Eigentümer sind. Für die Profitmaximierung und die »Kontrolle und Verwertung des Alltags« ging Amazon – um nur ein Beispiel zu nennen – schon vor der Krise rücksichtslos mit zehntausenden kleinen Unternehmen um – und erfüllt damit nur die wahren Erfolgsmerkmale des Kapitalismus.
Im Zuge der Krise und des Zusammenbruchs kleiner Läden wird sich diese Monopolisierung zu einem Tsunami entfalten. Die Entscheidung der kanadischen Regierung, Amazon im ganzen Land zum wesentlichen Lieferanten von persönlicher Schutzausrüstung zu machen, verschärft diese Entwicklung weiter. Dabei ignoriert die Regierung kaltblütig, dass Amazon nicht einmal seine Arbeiterinnen nur ausreichend vor dem Virus schützt.
Die Alternative zu diesem gigantischen Unternehmen, das sich nur sich selbst gegenüber verantwortlich zeigt, wäre eine Übernahme durch die öffentliche Hand, wie Mike Davis vorschlug, und es so zu einem Teil der sozialen Infrastruktur zum Gütertransport zu machen – beispielsweise als Erweiterung der Post. Würde es uns gehören, und nicht dem reichsten Menschen der Welt, könnte dessen operatives Geschäft zum Wohle der Bevölkerung demokratisch geplant werden.
Es ist entscheidend für eine demokratische Planung, die Mechanismen und Institutionen anzugehen, die einer solchen öffentlichen Teilhabe förderlich wären. Im Falle der Umwelt wird besonders deutlich, dass gesellschaftliches Planen für die Bekämpfung dieser eindeutigen Gefahr unerlässlich sind. Diese neue Art von Staat müsste nicht nur neue zentralisierte Kräfte besitzen, sondern auch eine ganze Reihe von dezentralen Planungsfähigkeiten, die bereits angedeutet wurden: regionale Forschungszentren, branchenspezifische Ausschüsse über Industrie- und Dienstleistungsgrenzen hinweg, lokal gewählte Umwelt- und Arbeitsplatz-Entwicklungs-Ausschüsse sowie Arbeitsplatz- und Nachbarschafts-Komitees.
Die Gesundheitskrise beweist insbesondere, wie wichtig es ist, dass sich die Arbeitsplätze in den Händen der Beschäftigten befinden – und auch die Chancen, die daraus entstehen. Dies gilt insbesondere für die Maximierung der Sicherheit vor den Risiken, die sie für uns eingehen und den Opfern, die sie für uns erbringen. Das trifft auch für die Arbeitenden zu, die mit ihrem Wissen das öffentliche Interesse schützen, indem sie den Schutz der Gewerkschaft nutzen, um als Whistleblower auf Abkürzungen und »Einsparungen« hinzuweisen, die sowohl die Sicherheit als auch den Standard der Produktion sowie des Produkts beeinträchtigen.
Die Gewerkschaften haben in letzter Zeit besser verstanden, dass sie die Öffentlichkeit auf ihre Seite bekommen müssen, um Tarifauseinandersetzungen zu gewinnen. Doch es bedarf noch mehr: Die Öffentlichkeit muss schrittweise durch weitergehende politische Forderungen gebunden werden (Lehrende und Pflegende machen dies zum Teil zumindest informell). Dies könnte zum Beispiel bedeuten, dem Staat gemeinsame Arbeit-Community-Komitees abzuringen, die regelmäßig Programme beobachten und gegebenenfalls modifizieren könnten. In der Privatwirtschaft könnte dies durch Arbeitsplatz-Umrüstungs-Komitees sowie branchenspezifische Arbeitsräte umgesetzt werden, die ihre eigenen Pläne präsentieren würden oder als Gegengewicht zu nationalen Plänen agieren, mit denen die wirtschaftliche Neuausrichtung und Umrüstung den neuen Umweltbedingungen angepasst werden würde.
»Eine besonders wichtige Entwicklung des letzten Jahrzehnts ist die Verschiebung von Protest zu Politik.«
Hier sind drei Punkte von entscheidender Bedeutung. Erstens: Eine weitreichende Beteiligung der Arbeitenden durch eine Ausweitung der gewerkschaftlichen Organisierung, um für die Arbeitenden ein institutionelles, kollektives Gegengewicht zu den Arbeitgeberinnen zu schaffen. Zweitens: Eine solche lokale und branchenspezifische Beteiligung muss die Einbindung und Transformation der Staaten beinhalten, um nationale und lokale Planung miteinander zu verknüpfen. Drittens: Es reicht nicht, wenn Staaten transformiert werden – Organisationen der Arbeiterinnenklasse müssen es auch. Dies betrifft sowohl die Organisation als auch den Umgang mit den Interessen der Mitglieder. Das gewerkschaftliche Versagen der letzten Jahrzehnte ist untrennbar verbunden mit dem störrischen Festhalten an einer fragmentierten und defensiven Gewerkschaftsarbeit, wie sie noch immer gesellschaftliche Realität ist. Dies steht im genauen Gegensatz zu einer klassenkämpferischen Gewerkschaftsarbeit, die wir nun brauchen und die auf breiterer Solidarität und ambitionierteren, radikalen Vorstellungen basieren muss.
Die Klasse organisieren
Eine besonders wichtige Entwicklung des letzten Jahrzehnts ist die Verschiebung von Protest zu Politik. Von Teilen der Bewegung wurden die Grenzen vom Protest und die daraus folgende Notwendigkeit, mit der gewählten Macht und den Staat umzugehen, erkannt. Womit wir noch zu kämpfen haben ist was für eine Art von Politik nun wirklich die Gesellschaft verändern kann.
Auch wenn die Möglichkeiten, die Jeremy Corbyn und Bernie Sanders innerhalb etablierter Parteien eröffnet haben, beeindruckend sind, sind beide doch an die Grenzen dieser Parteien gestoßen. Corbyn ist raus und Sanders hat gerade seinen Wahlkampf beendet. Die politische Gefahr besteht nun, da man so weit gekommen ist und doch enttäuscht wurde und es keine klare politische Heimat mehr gibt, dass die Kombination von individueller Erschöpfung, kollektiver Entmutigung und Uneinigkeit darüber, in welche Richtung es weitergehen soll, all jenes auseinandertreibt, das sich so hoffnungsvoll entwickelt hat.
Den unmittelbaren Zusammenbruch des Kapitalismus hinauszuposaunen wird uns nicht weit bringen. Solche Behauptungen mögen zwar mancherorts beliebt sein, doch wenn wir die Unvermeidbarkeit des herannahenden kapitalistischen Zerfalls übertreiben, verwischen wir damit, was getan werden muss, um den langen, harten, unendlichen Kampf zur Veränderung der Welt zu führen. Es ist eine Sache, aus der tiefgreifenden Krise des Kapitalismus und seinem anhaltenden Irrsinn Hoffnung zu schöpfen. Doch die Krise, auf die wir uns konzentrieren müssen, ist eine interne: die Krise der Linken selbst. Die folgenden vier Bestandteile sind grundlegend, um jetzt maßgebliche linke Politik zu stützen und aufzubauen.
- Arbeitende Menschen während der Krise verteidigen
Ein einfacher (breit gefasster) Ausgangspunkt ist die Beschäftigung mit den unmittelbaren Interessen der Arbeitenden. Der »Notfallplan für die Coronavirus-Pandemie« von Bernie Sanders ist in dieser Hinsicht eine wertvolle Ressource, auch wenn es nicht ganz so weit in eine sozialistische Richtung geht wie Doug Henwood (siehe dazu »Jetzt ist die Zeit gekommen, um Amerika fundamental zu verändern«).
- Institutionelle Kapazitäten aufbauen und erhalten
Da es in den USA keine linke politische Partei und sich die Wahlchancen für Sanders verflüchtigen, geht es nun für die Linke, die innerhalb der demokratischen Partei agierte, darum, eine gewisse institutionelle Unabhängigkeit vom Establishment der Demokratischen Partei zu wahren. Der einzige Weg für die Linke scheint es, sich auf strategisch ausgewählte nationale Kampagnen zu konzentrieren. Die Umwelt könnte eine sein, der Kampf um universale Krankenversicherung scheint eine logische zweite Wahl. Die dritte Kampagne könnte eine Arbeitsrechtsreform betreffen. Diese wäre nicht nur an und für sich wichtig, nachdem Arbeitsrechte jahrelang mit den Füßen getreten wurden. Sie wäre außerdem entscheidend, um die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen in den USA entscheidend verschieben.
- Bildet Sozialistinnen und Sozialisten aus
Die Kampagne von Sanders zeigt das überraschende Potenzial, Spenden zu sammeln und zehntausende entschlossener Aktivistinnen zu rekrutieren. Nach Sanders Niederlage 2016 argumentierte Jane McAlevey, dass die Zeit gekommen sei, diesen Enthusiasmus für die Gründung regionaler Organizing-Schulen zu nutzen. Darauf aufbauend müssen wir Schulen etablieren, die sozialistische Kader ausbilden. Menschen, die analytisches und strategisches Denken mit sich bringen und mit der Fähigkeit verbinden, nicht überzeugte Arbeiterinnen und Arbeiter anzusprechen und zu organisieren. Sie könnten wie die Sozialistinnen und Sozialisten der 1930er nicht nur eine wichtige Rolle bei der Verteidigung von Gewerkschaften spielen, sondern auch bei deren Transformation. All diese Kampagnen, Schulen, Lerngruppen, offenen Foren, Magazine und Journale wären Infrastrukturelemente einer möglichen linken Partei.
- Organisiert die Klasse
Andrew Murray, Stabschef der britischen und irischen Gewerkschaft UNITE, hat den Unterschied zwischen einer Linken aufgezeigt, die sich auf die arbeitende Klasse konzentriert, und einer Linken, die in dieser Klasse verwurzelt ist. Die größte Schwäche der sozialistischen Linken ist ihre begrenzte Verankerung in den Gewerkschaften und den Communitys der arbeitenden Menschen. Nur wenn die Linke diesen Graben überwinden kann – und es ist sowohl ein kultureller als auch ein politischer Graben – besteht die Möglichkeit, eine geschlossene, selbstbewusste und unabhängig kämpferische Arbeiterinnenklasse zu entwickeln, die in der Lage ist, eine Vision zu entwickeln, die den Kapitalismus grundlegend herausfordert.
Als uns die Finanzkrise von 2008-9 traf, verstanden viele von uns dies als eine endgültige Diskreditierung des Finanzsektors, wenn nicht gar des Kapitalismus an sich. Damit lagen wir falsch. Der Staat intervenierte, um das Finanzsystem zu retten. Die Finanzinstitute gingen gestärkt aus der Krise hervor – so stark wie nie zuvor. Der Kapitalismus in seiner neoliberalen Form machte weiter.
Dieses Mal entspringt die Krise einer Pandemie. Die Infragestellung kapitalistischer Autorität entsteht aus der Reaktion der Staaten auf diese Bedrohung. Eine kapitalistische Binsenwahrheit nach der anderen wurde weggefegt – Begrenzungen von Haushaltsdefiziten, mangelnde Gelder für die Erhöhung der Arbeitslosenabsicherung, die Unmöglichkeit, schließende Fabriken umzurüsten, die Glorifizierung des unternehmerischen Strebens nach Profit über alles andere, die Entwertung der Menschen, die unsere Krankenhäuser reinigen und unsere Alten pflegen. Scheint da die Zeit für radikalen Wandel nicht gekommen zu sein?
Vielleicht. Doch es hat der Linken nie gut getan, an substantiellen Wandel zu glauben, der von der sozialen Handlungsmacht losgelöst ist und nur aus den abstrakten Widersprüchen entspringt. Veränderung entsteht aus der Entwicklung kollektiver Vorstellungen, Fähigkeiten, Praktiken, strategischen Einsichten und vor allem aus demokratischen Organisationen. Damit überzeugen wir diejenigen, die auf unserer Seite stehen sollten, es aber nicht tun. Damit erhöhen wir die öffentlichen Erwartungen und Zielsetzungen. Damit stellen wir uns mutig jenen entgegen, die uns den Weg versperren werden.
Sam Gindin war von 1974 bis 2000 Forschungsdirektor der Canadian Auto Workers. Er ist Co-Autor (zusammen mit Leo Panitch) von »The Making of Global Capitalism« (Verso) und Co-Autor (zusammen mit Leo Panitch und Steve Maher) von »The Socialist Challenge Today«.