13. September 2021
Demolierte Demokratie
Der Politikwissenschaftler Colin Crouch hat ein Buch über Postdemokratie geschrieben. Schon wieder. Antworten hat er immer noch keine.
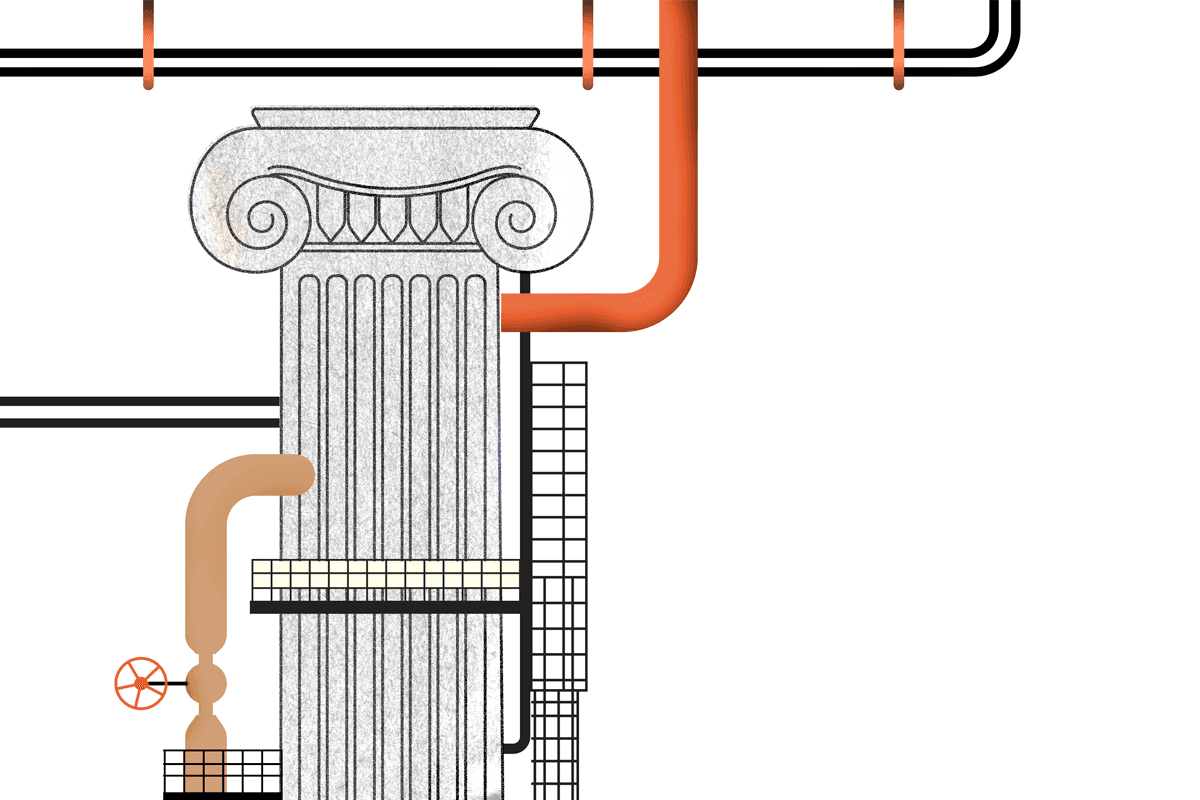
Als die am Kreml angebrachten Lettern »CCCP« samt Sowjet-Staatswappen durch fünf Doppeladler ersetzt wurden und allmählich die ersten virtuellen Tamagotchi-Küken schlüpften, schien die Demokratie gesiegt zu haben. Doch nach dem Ende des Systemwettkampfs traten deren innere Widersprüche umso deutlicher in Erscheinung. Zehn Jahre später brachte der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch in seinem Essay Postdemokratie ein zentrales Unbehagen auf den Begriff: Was ist, wenn die demokratischen Institutionen in den westlichen Ländern zwar formal intakt sind, demokratische Verfahren und Regierungen aber mehr und mehr von ökonomischen Eliten und ihrem medialen Politikspektakel dominiert werden?
Crouchs Buch wurde damals breit diskutiert und in den Sozialwissenschaften knüpften zahlreiche Forschungsprojekte an die These der Postdemokratie an. Im April dieses Jahres legte er mit Postdemokratie revisited nun eine erneute Bestandsaufnahme der Demokratie in den westlichen Ländern vor. Seine Diagnose ist dabei kaum überraschend: 2021 sei es um den Zustand der Demokratie fast überall schlechter bestellt als zu Beginn des Jahrhunderts. Eine erste Begründung dafür gibt Crouch mit Blick auf die Durchsetzung der neoliberalen Ideologie: »Die Lehre, dass die Einmischung der Wirtschaft in die Politik etwas Gutes sei«, so heißt es in seinem neuen Buch, »hat in hohem Maße zu postdemokratischen Verhältnissen beigetragen, indem sie die Verlockung der politischen Klasse verstärkt hat, engen Kontakt zu den Wirtschaftseliten zu suchen.« Ein prominentes Beispiel dafür sei Gerhard Schröder, der während seiner Kanzlerschaft Verträge für Gaslieferungen aus Russland abschloss und hinterher in den Vorstand des Energiekonzerns Gazprom wechselte. Auch würden heute ehemalige Berater von Obama Führungspositionen bei Amazon bekleiden. Gemeint sein dürfte Jay Carney, der zeitweise stellvertretender Pressesprecher im Weißen Haus war, also dem absoluten inner circle angehörte. Dieses »Personalkarussell« führe zu einem starken Einfluss der Wirtschaft auf die Politik. Der Übergang zur Korruption ist dabei Crouch zufolge fließend, weil unternehmerischer Einfluss auf den Staat im Neoliberalismus grundsätzlich begrüßt wird.
Die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen habe diese postdemokratische Tendenz noch verstärkt. Großbritannien etwa sei heute – vom Rüstungsgeschäft bis zur Sozialfürsorge – abhängig von privaten Firmen, die darum konkurrieren, behördliche Ausschreibungen zu gewinnen. Dabei geht es häufig darum, »über gute Kontakte zu Beamten und Politikern zu verfügen« – die deutschen Maskendeals lassen grüßen. In den vergangenen Jahrzehnten zeigte sich die Postdemokratie Crouch zufolge allerdings nirgends so paradigmatisch wie in der Bewältigung der sogenannten Eurokrise, also der vielschichtigen Währungs-, Banken- und Schuldenkrise in Europa ab 2010. Wie schon in der Finanzkrise 2008 wurden hier vor allem die Banken stabilisiert, während man die Bevölkerung – vor allem der Länder des europäischen Südens – einem brutalen Disziplinarregime unterwarf.
Crouchs Pointe: Schon die mit dem Krisenmanagement beauftragten Institutionen wie die Europäische Zentralbank, die Europäische Kommission und der Internationale Währungsfonds waren nur indirekt demokratisch legitimiert. Wie der Journalist Aditya Chakraborty aufgedeckt hat, nahmen an den Treffen der sogenannten Troika dann aber auch noch heimlich Lobbyisten des International Institute for Finance teil, einer Vereinigung von 450 Privatbanken aus aller Welt. Crouch sieht hierin zurecht ein Beispiel von Postdemokratie in Reinform: »Die stillschweigende Einbettung privater und partikularer Unternehmensinteressen in staatliche Entscheidungsprozesse«. Er macht in seinem Buch unmissverständlich klar, dass wir diese Aushöhlung des Politischen in fast allen westlichen Ländern beobachten können. Die Folgen sind bekannt: extreme ökonomische Ungleichheit, politische Apathie bei großen Teilen der Bevölkerung und die Unfähigkeit, der Klimakatastrophe mit einer tiefgreifenden Transformation der Gesellschaft zu begegnen.
Der Skylla der Postdemokratie stellt Crouch eine Charybdis der – wie er es nennt – »nostalgischen Pessimisten« zur Seite. Damit sind vor allem die neurechten Kräfte gemeint, die seit einigen Jahren in vielen Demokratien zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft geworden sind. Crouch räumt ein, dass er deren rasanten Aufstieg in Postdemokratie nicht voraussehen konnte – leider liefert er in seinem aktuellen Buch aber nicht viel Neues, um diesen Aufstieg zu erklären.
Spätestens bei den Vorschlägen, was diesen unerfreulichen Entwicklungen entgegenzusetzen sei, ist man genervt: Crouchs Antworten auf die Krise lesen sich ungefähr so phrasenhaft wie das SPD-Wahlprogramm. Gut wären seiner Ansicht nach ein Revival der Gewerkschaften und die Bewahrung der Europäischen Einheit sowie der Autonomie von Wissenschaft, Justiz und Medien. Die Wiederbelebung der Demokratie soll von der Zivilgesellschaft ausgehen – dem Klimaaktivismus oder den feministischen Bewegungen zum Beispiel. Die Parteien müssten sich mit diesen verbinden und »von ihnen lernen«. Natürlich muss ein Politikwissenschaftler keine ausgearbeitete politische Strategie vorlegen – doch der schonungslosen Analyse des Verfalls der Demokratie steht hier auf so auffällige Weise die blutleere Verteidigung bestehender demokratischer Institutionen gegenüber, dass man sich wundert und geneigt ist, Crouchs Position als Symptom zu lesen: Obwohl die meisten liberalen Demokratinnen die katastrophale Lage unserer Gesellschaften sehr genau sehen, sind sie nicht bereit, eine wirklich radikale demokratische Haltung einzunehmen.
Diese bestünde in der Forderung nach der Demokratisierung der Ökonomie selbst – von der Ausweitung der betrieblichen Demokratie bis zur Vergesellschaftung und Umprogrammierung des Finanzmarktes als dem zentralen Nervensystem des Kapitalismus gibt es mittlerweile genügend ernstzunehmende Vorschläge. Liberale Institutionen werden wir nur bewahren, wenn wir unter demokratische Kontrolle bringen, was sie zerstört.
Matthias Ubl ist Contributing Editor bei Jacobin und Chef vom Dienst beim Wirtschaftsmagazin Surplus.