15. April 2022
Die Ära Tesla
Tesla baut nicht nur elektrische Autos, es schafft eine ganz neue Produktionsweise. Klimabewegung und Gewerkschaften müssen einen Gang hochschalten.
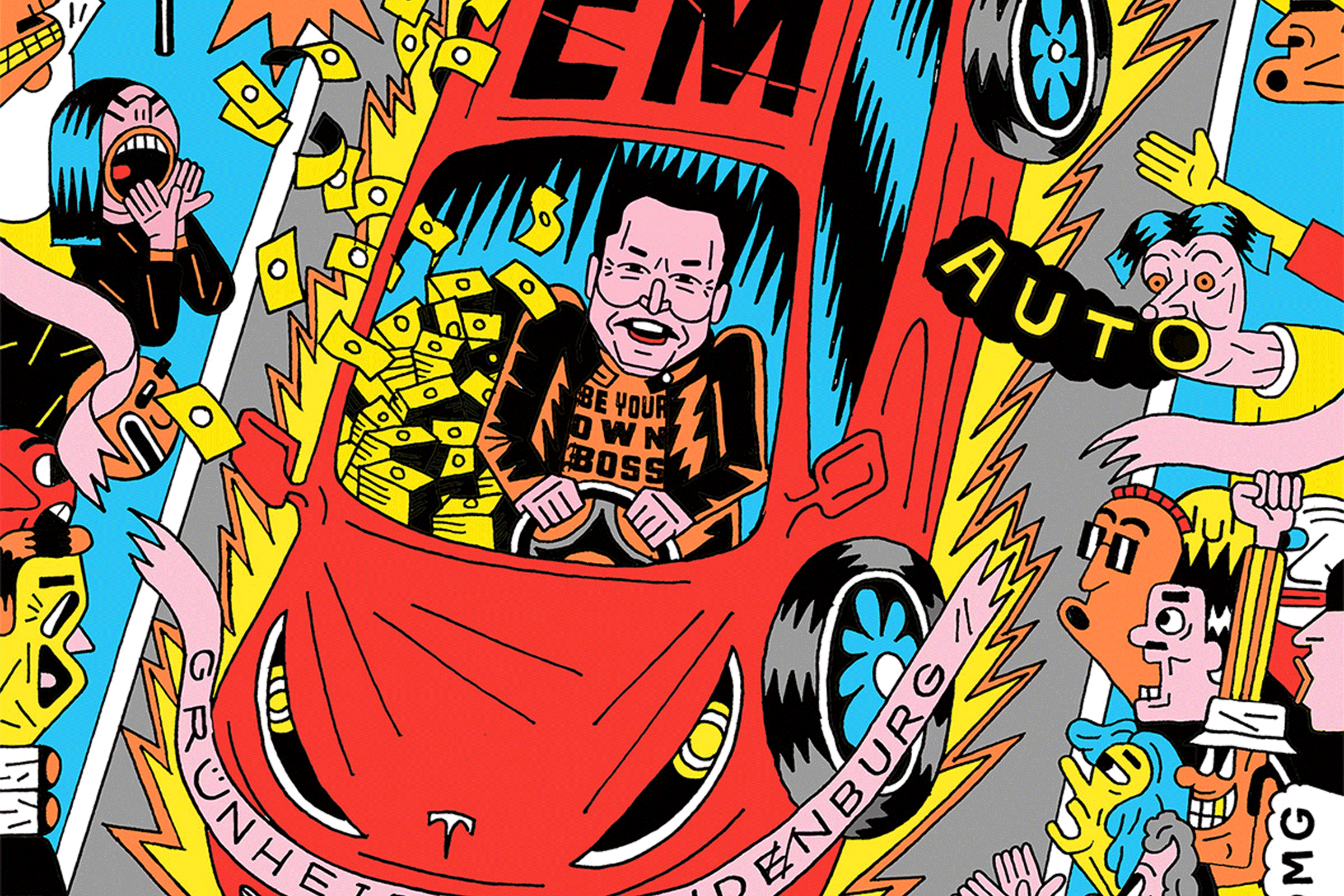
Wer mag schon Tech-Milliardäre? Auf der Linken nicht so viele – und aus guten Gründen. Denn diese »Unternehmerpersönlichkeiten« aus dem Silicon Valley stehen für eine ultraliberale Weltverbesserungs-Hybris, die keine Rücksicht auf natürliche und menschliche Ressourcen nimmt.
Das gilt auch für Tesla-CEO Elon Musk, der mit seiner bekannten Aversion gegen Gewerkschaften als Paradebeispiel eines skrupellosen Tech-Entrepreneurs gilt. Es ist leicht, ihn als einen Scharlatan abzutun, der einfach nur das PR-Geschäft versteht und mit Versprechen von Marsflügen und Bitcoin-Spekulation den Wert seiner Unternehmen künstlich aufbläht. Die Linke täte jedoch gut daran, ihn als ökonomischen Akteur ernst zu nehmen, denn Tesla ist seiner Konkurrenz weit voraus und wird die Herstellung von Elektroautos auf absehbare Zeit dominieren. Und das gilt insbesondere für die deutsche Linke – schließlich startet demnächst in Grünheide bei Berlin die Tesla-Produktion für den europäischen Markt.
Der Linksfraktionschef Dietmar Bartsch macht derweil Stimmung gegen Tesla: »Wir machen vor allen Dingen Politik für die Polo-Fahrerinnen und nicht für den Tesla-Jünger«, ließ er sich zitieren und bekräftigte seine Forderung nach billigem Benzin. Auch der vermeintlich immense Wasserverbrauch der neuen Fabrik war in der Linken Top-Thema. Dabei verbraucht ein anderes Unternehmen in Brandenburg etwa das Achtzigfache der Tesla-Fabrik – nämlich der Braunkohletagebaubetreiber LEAG, der das auch noch bis 2038 weiter tun darf, dank tatkräftiger Unterstützung der Gewerkschaften und der SPD-geführten Landesregierung.
Der DGB-Chef Reiner Hoffmann warnt vor »weiterer Amerikanisierung« durch Musk: »Sie verträgt sich nicht mit unseren Vorstellungen von sozialer Marktwirtschaft.« Dem deutschen Autokapital kann das nur recht sein. Und auch die radikale Linke macht mit: Zu einem Brandanschlag auf die Tesla-Baustelle bekannte sich die Gruppe Vulkan. »Tesla ist weder grün, ökologisch noch sozial«, stellt sie im Bekennerschreiben fest. Aber stimmt das nicht für so ziemlich jedes kapitalistische Unternehmen? Warum trifft es also ausgerechnet einen US-amerikanischen Elektroautohersteller?
Vom Start-Up zum Digitalkonzern
2006 stellte das noch junge Startup den Roadster vor, einen 110.000 Dollar teuren Sportwagen, der vom britischen Autozulieferer Lotus gefertigt wurde. Damit war bewiesen, dass es möglich ist, einen zuverlässigen und performanten Sportwagen mit Batteriebetrieb in kleinen Stückzahlen zu bauen – nicht mehr und nicht weniger.
Wie für ein Startup üblich schrieb Tesla lange Zeit nur rote Zahlen, schrammte 2008 sogar knapp an der Pleite vorbei. Haupteinnahmequelle war lange Zeit der Verkauf von Emissionszertifikaten an andere Hersteller. Ähnlich wie beim Emissionshandel unter Kraftwerken ermöglichte dieser »sauberen« Unternehmen, Zertifikate für die Verschmutzung an andere Unternehmen zu verkaufen.

2012 ging Tesla mit dem Model S die Kleinserienproduktion einer Luxuslimousine an. 2017 gelang ihm dann, was viele in der Branche nicht für möglich gehalten hatten: der Beginn der Massenproduktion des Mittelklassewagens Model 3. Als nächstes stehen ein günstiges Einstiegsmodell und der Cybertruck auf dem Plan, der auf den in den USA so bedeutenden Pick-Up-Markt abzielt.
Selbsterklärtes Ziel von Tesla ist es von jeher, günstige E-Autos für den Massenmarkt zu bauen. Mit jedem Modell und mit jeder weiteren Ausbaustufe sollten Erfahrungen für die jeweils nächste gesammelt werden. Das hat bislang gut geklappt – Tesla ist mittlerweile der größte E-Auto-Hersteller. 2021 lieferte das Unternehmen gut 936.000 Fahrzeuge aus – ein Plus von 87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Demgegenüber hat Volkswagen gerade einmal 263.000 reine E-Fahrzeuge verkauft. Demnächst geht nicht nur in Grünheide bei Berlin, sondern auch in Texas ein nagelneues Werk an den Start.
Der Anteil der Einnahmen aus dem Zertifikate-Handel schrumpft in den letzten Jahren, denn die anderen Autohersteller bringen zunehmend selbst als emissionsfrei klassifizierte Fahrzeuge auf den Markt. Für das Jahr 2021 lag der Anteil des Zertifikate-Handels am Umsatz von Tesla bei nur noch 2,7 Prozent.
Rechtzeitig mit dem Auslaufen dieser Einnahmequelle hat sich Tesla zum Massenhersteller entwickelt, der mehr batterieelektrisch betriebene Autos baut als irgendjemand sonst – und zudem viel profitabler. Die Schweizer Großbank UBS geht davon aus, dass Tesla als einziges Unternehmen mit dem Verkauf von E-Autos Geld verdient.
»Es hat ein digitales Ökosystem rund um seine Fahrzeuge entwickelt, in dem das Auto Nebenprodukt einer Softwareplattform ist.«
Tesla verdient nicht einfach nur Geld mit seinen E-Fahrzeugen, sondern auch noch mit beeindruckenden Margen: 30 Prozent Gewinn pro Fahrzeug, hat Eim Eun-young, Analyst bei Samsung Securities, ausgerechnet – das ist eher im Bereich dessen, was Plattformunternehmen wie Apple, Uber oder Amazon einstreichen. Das spiegelt sich auch in der Bewertung an der Börse wider: Tesla wird derzeit circa siebenmal so hoch bewertet wie die Volkswagen AG, obwohl das Wolfsburger Unternehmen im vergangenen Jahr etwa zehnmal so viele Autos verkauft hat.
Allerdings läuft auch bei Tesla nicht alles rund: Die ewigen Versprechen rund ums autonome Fahren sowie Prozesse wegen mutmaßlicher Insidergeschäfte kratzen an der Reputation. Auch häufen sich Berichte über Arbeitsstress und toxische Arbeitskultur in Teslas Fabriken sowie Proteste wegen rassistischer Diskriminierung – irgendwo muss die hohe Profitabilität ja herkommen.
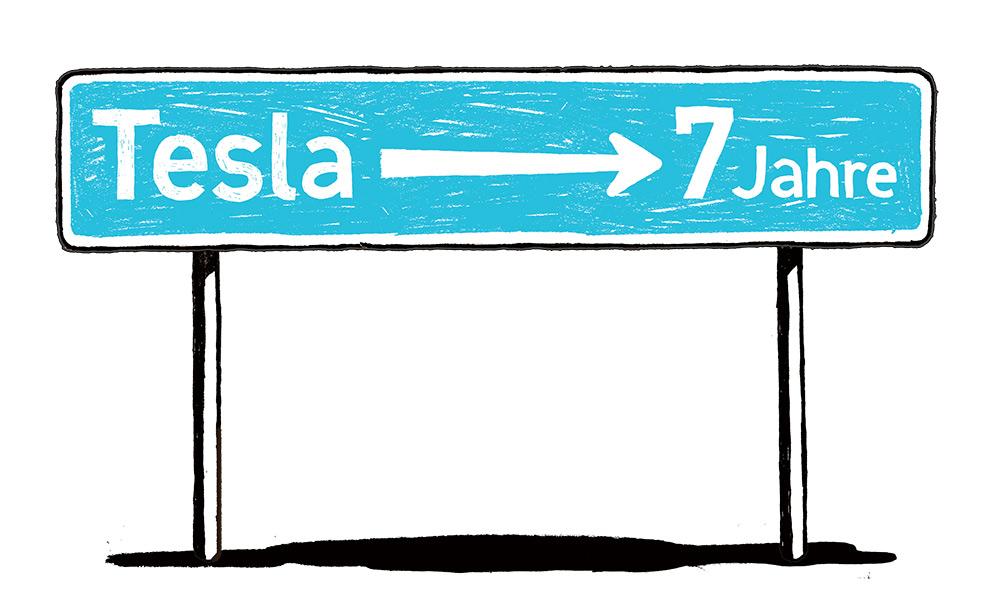
Der Konkurrenz voraus
In der Branche herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla in allen relevanten Bereichen technologisch führend ist. Bei den Batterien, der Ladeinfrastruktur, ja sogar bei Chip-Design und Antriebstechnik beträgt der Vorsprung zwischen drei und sieben Jahren, wenn man den Analysten Glauben schenkt.
Die vertikale Integration ist bei Tesla im Vergleich zu anderen Autoherstellern viel ausgeprägter. Es kontrolliert die gesamte Wertschöpfung von der Batterie- und Karosserieherstellung über den Vertrieb, die Software und die Kundenbeziehungen bis hin zu Aktivitäten auf dem Strommarkt. Tesla hat ein eigenes Betriebssystem entwickelt und baut seine eigenen Computerchips; sein weltweites Lade-Netz ist konkurrenzlos.
Den größten Vorsprung hat Tesla aber im Bereich Software. Bei Updates und Fernwartung kann ihm niemand das Wasser reichen. Tesla als Autohersteller ernst zu nehmen, genügt bei weitem nicht. Es hat ein digitales Ökosystem rund um seine Fahrzeuge entwickelt, in dem das Auto Nebenprodukt einer Softwareplattform ist.
Die Fahrzeuge sind Teil eines Netzes von Geräten, die permanent mit Tesla verbunden sind und während des Betriebs Daten an die Zentrale liefern. Der Soziologe Peter Schadt spricht in diesem Zusammenhang von dual use: Die Produkte generieren während der Nutzung Daten, die neuen Produkten als Grundlage dienen. Es handelt sich also um Produkte, die gleichzeitig als Produktionsmittel fungieren.
Auch beim Thema Fertigung geht das Unternehmen neue Wege. Die weltweit größten Druckgussmaschinen kommen bei Tesla zum Einsatz – mit dem Ziel, Produktionsschritte und damit Kosten einzusparen. Ständige Produktinnovationen, die als Update in die laufende Produktion einfließen, kennen wir aus dem Softwarebereich – Tesla hat diese Logik auf das Auto übertragen. In der Folge ist es auch bei der Produktivität seiner Konkurrenz davongelaufen. Volkswagen braucht nach Aussage von CEO Herbert Diess in seinem Zwickauer Werk dreimal so lang, um den ID3 zu bauen – das Modell, mit dem der Konzern an die Erfolgsgeschichte von Käfer und Golf anknüpfen möchte.
»Tesla torpediert den fossilen Klassenkompromiss.«
Derzeit sind die E-Fahrzeuge der deutschen Hersteller weder konkurrenzfähig noch profitabel. Trotzdem ist man in der Industrie zuversichtlich, diesen Vorsprung in wenigen Jahren einholen zu können. Doch selbst wenn Tesla ab sofort jegliche Forschung und Entwicklung einstellte, würde es Jahre dauern, bis die etablierten Hersteller technologisch aufschließen könnten.
Das größte Problem der deutschen Hersteller ist allerdings, dass sie immer noch fast ausschließlich Verbrenner produzieren. Ob Volkswagen oder Daimler – 2021 waren das 95 Prozent der Fahrzeuge, die dort vom Band liefen. VW will diesen Anteil bis 2030 zwar auf 30 Prozent verringert haben, in der Zwischenzeit müssen jedoch Ressourcen für beide Antriebstechnologien bereitgestellt werden, womöglich sogar noch länger. Selbst wenn dies gelingt, bleibt jedoch fraglich, ob die restlichen 30 Prozent Verbrenner dann noch Abnahme finden. In Norwegen sind schon heute 80 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge batteriebetrieben.
Disruptive Elektrifizierung
Henry Ford war beileibe kein sympathischer Typ. Für seine Arbeiter hatte er nichts als Verachtung übrig und er war bekennender Fan von Adolf Hitler (was übrigens auf Gegenseitigkeit beruhte). Als Industrieller trat er jedoch nicht nur mit einem Produkt an, sondern mit einem »sozialen Programm«: »jedermann sollte sich ein auto kaufen können«, fasste es der Designer Otl Aicher zusammen. Er führte das Fließband in die Autoproduktion ein und leitete damit eine Etappe in der Geschichte des Kapitalismus ein, die sogar nach ihm benannt ist: den Fordismus.
Mit Tesla ist es ähnlich. Elon Musk piesackt seine Leute wie Henry Ford – nur diesmal mit agilen Methoden statt mit Taylors Fließband. Dabei etabliert er eine neue Produktionsweise für ein digitales Produkt auf Rädern. Tesla betreibt »den Automobilbau mit den neuen Geschäftsmodellen der Internetunternehmen«, schreiben die Münchner Experten Andreas Boes und Alexander Ziegler. Es führt kein Weg daran vorbei, Tesla als den derzeit und wohl auch für die nächsten Jahre tonanagebenden Auto-Digitalkonzern neuen Typs zu erkennen.
Tesla ist für die Linke auch deshalb interessant, weil es die Elektrifizierung des Autos beschleunigt. Die Autokonzerne und -verbände, aber auch die IG Metall hatten sich auf ein gemächliches Hochfahren der Elektromobilität eingestellt und sind auf das von Tesla diktierte Tempo nicht vorbereitet. Was wir derzeit erleben, ist der Beginn einer Entwicklung, die man als »disruptive Elektrifizierung« bezeichnen kann.
Tesla torpediert so den »fossilen Klassenkompromiss« – so die kluge Formel des Soziologen Simon Schaupp für das Bündnis aus Autokonzernen, Staat und organisierter Arbeit rund um die »automobile Lebensweise«, die wiederum Ulrich Brand und Markus Wissen als ein zentrales Element des deutschen Gesellschaftsvertrags ausweisen.
Teslas Push in Richtung Elektro(auto)mobilität zwingt auch die Gewerkschaften, sich langsam aber sicher von diesem zu verabschieden. Am Tesla-Standort in Brandenburg versucht die Gewerkschaft nun die Kolleginnen und Kollegen zu organisieren, und Birgit Dietze, Bezirksvorsitzende der IG Metall in Berlin, lobte Musk zuletzt gar als ersten Unternehmer seit Jahrzehnten, der Tausende Industriearbeitsplätze in Brandenburg schaffen würde. Bei der am 28. Februar über die Bühne gegangenen Betriebsratswahl war die IG Metall hingegen durch den frühen Termin überrascht worden. Tesla hatte die Wahl zu einem Zeitpunkt angesetzt, da erst wenige Beschäftigte aus der Produktion eingestellt waren, sodass die Angestellten aus dem Management in der Zusammensetzung des Betriebsrats überrepräsentiert sein würden.
Die IG Metall täte gut daran, sich auf diesen neuen Player in der Branche und seine Strategie einzustellen und eine Gegenmacht aufzubauen, mit der sie effektiv gegen intensivierte Ausbeutungsmethoden bei Tesla vorgehen kann. Hier könnte sie vermutlich aus Kämpfen rund um Google und Facebook lernen, zum Beispiel von der in Berlin sehr aktiven Tech Workers Coalition.
Wir bekommen dank Tesla zwar eine schnellere Elektrifizierung der PKW-Flotte, einer echten Antriebswende – also der kompletten Dekarbonisierung des Verkehrssektors – kommen wir damit jedoch nicht automatisch näher. Und eine Verkehrswende weg vom privaten PKW als dem Symbol und Vehikel des Nachkriegs-Wohlstandsmodells können wir von Musk wohl genauso wenig erwarten wie von seiner hiesigen Konkurrenz. Das müssen wir schon selber leisten.
Timo Daum ist Sachbuchautor und Gast der Forschungsgruppe »Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung« am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).