13. Dezember 2021
Die Strategie der großen Schritte
Sozialistische Politik steht für einen radikalen Reformismus, der mehr will als Reförmchen. Zwei Denker der Neuen Linken weisen den Weg.
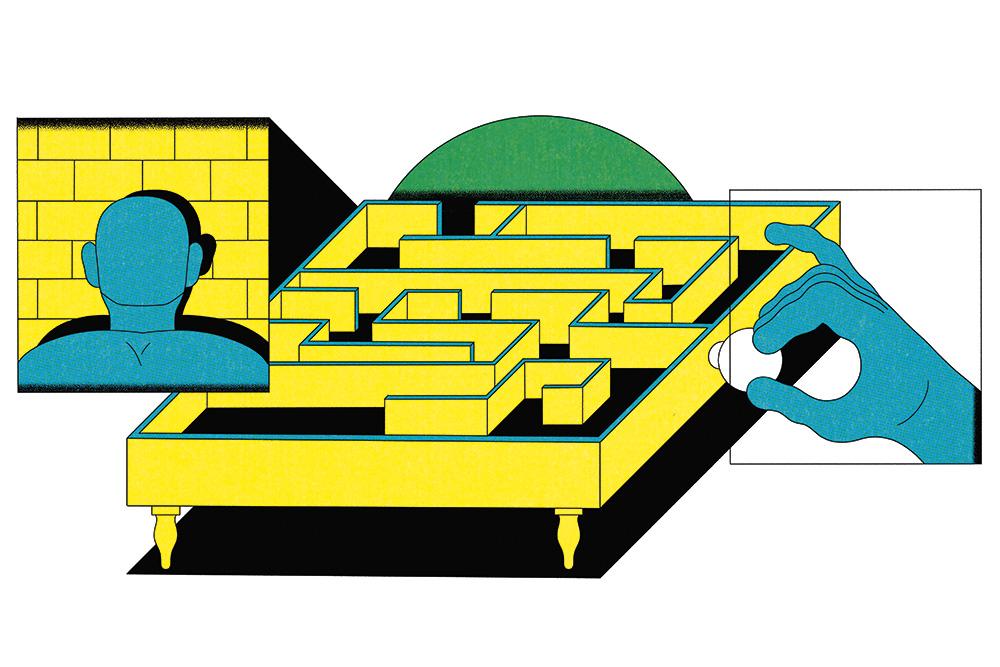
Im Jahr 1940, kurz vor dem »Blitz« – jenem monatelangen Dauer-Bombardement, mit dem die Nazis die britischen Großstädte überzogen – stand ein Junge am Grab von Karl Marx in London. Er und sein Vater, ein jüdischer Lederarbeiter aus Polen, waren erst kürzlich von dem Boot gestiegen, das sie aus dem besetzten Belgien in Sicherheit gebracht hatte. In der Stille des Highgate Cemetery schwor der Junge der Sache der Arbeiterinnen und Arbeiter Treue. Seinen Geburtsnamen, Adolphe, legte er aus naheliegenden Gründen ab. Ralph Miliband nannte er sich für den Rest seines Lebens, in dem er sein jugendliches Ehrenwort hielt.
Flucht und Wandlung prägten auf der anderen Seite des Ärmelkanals auch die Jugend von Gerhart Hirsch. 1923 – ein Jahr vor Miliband – in Wien geboren, entging er dem Naziterror in einem Schweizer Internat. Später siedelte er nach Frankreich über und wurde Autor und Journalist. Auch er gab sich einen neuen Namen: André Gorz.
Gorz und Miliband wurden ab den 1950er Jahren zu wichtigen Figuren der Neuen Linken in Frankreich und Großbritannien. Sie waren politisch ambitioniert genug, sich weder von der Versteinerung des Realsozialismus noch von der Laschheit einer zunehmend staatstragenden Sozialdemokratie vereinnahmen zu lassen. Beide erkannten, dass die leninistische Revolutionsstrategie in den westlichen Ländern jeden Realitätsbezug verloren hatte. Gleichzeitig galt es, nicht in die Falle der realexistierenden Sozialdemokratie zu tappen und aufzugeben, was der Reformismus ursprünglich zum Ziel hatte: die Überwindung des Kapitalismus. Für Gorz bildeten »nicht-reformistische Reformen« den Kern dieser sozialistischen Strategie. Miliband sprach von einem »starken« oder »revolutionären Reformismus«.
Sozialismus-Grade
Miliband verstand darunter Reformen, die nicht isoliert für sich stehen, sondern mit der Vision eines revolutionären Fernziels verbunden sind. Gorz betonte, dass solche Reformen den Anspruch verfolgen sollten, weitere, größere Reformschritte zu erleichtern. Dazu müsse jede Reform das gesellschaftliche Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit zugunsten der Arbeitenden verschieben und diese politisch aktivieren. Nicht-reformistische Reformen können für Gorz nicht »lediglich durch Regierungsbeschluss eingeführt und durch bürokratische Maßnahmen verwaltet« werden – beides müsste unter breiter Beteiligung der Bevölkerung geschehen. Auch müsste ein revolutionärer Reformismus nach Miliband bedenken, dass »jede ernsthafte Herausforderung der herrschenden Klassen unvermeidlich Widerstand hervorrufen« wird, und sich dagegen wappnen.
Von herkömmlichen sozialstaatlichen Reformen hebt sich die von Miliband und Gorz skizzierte Politik vor allem dadurch ab, dass sie neben der Linderung der unmittelbaren sozialen Leiden immer auch eine politische Stärkung der Lohnabhängigen als Klasse verfolgt. Dass beides nicht notwendig miteinander einhergeht, zeigt das berühmte Beispiel der Schaffung des deutschen Sozialstaats durch Otto von Bismarck: Diese beinhaltete einerseits die Einführung der Sozialversicherung, andererseits aber ein Verbot sozialistischer Vereinigungen. Das ist natürlich ein Extremfall. Aber auch viele andere sozialpolitische Maßnahmen führen beabsichtigt oder unbeabsichtigt dazu, die Arbeitenden eher zu beschwichtigen und den Klassenkampf zu entschärfen, anstatt ihn, wie Gorz und Miliband es vorsahen, auf eine neue Stufe zu heben. Reformistische Reformen verbessern bestenfalls die Lebensverhältnisse, nicht-reformistische Reformen verschieben gleichzeitig auch die Machtverhältnisse.
1968 veröffentlichte Gorz seinen Essay »Reform and Revolution« in der von Miliband gegründeten Zeitschrift Socialist Register. Darin schrieb er, sozialistische Strategie habe erstens die Vergrößerung der Macht der arbeitenden Bevölkerung »durch direkte Demokratie in den großen Betrieben und eine starke Präsenz in Parlamenten« zum Ziel und bezwecke zweitens, »Güter und Dienstleistungen der kollektiven Bedürfnisbefriedigung der Herrschaft des Marktes zu entziehen«. Wenn gesellschaftliche Güter anstatt über das Gesetz der zahlungskräftigsten Nachfrage nach dem Modus sozialer Rechte zugänglich gemacht werden, dann entzieht das dem Kapital seine zentrale Machtquelle: die private Verfügung über die Wirtschaft. Eine Demokratisierung der politischen Institutionen, der Arbeit und des Eigentums erhöht umgekehrt die Macht der arbeitenden Bevölkerung und befähigt sie, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Unter dem Gesichtspunkt des revolutionären Reformismus sind Gesellschaften nicht erst kapitalistisch und werden dann irgendwann auf einen Schlag sozialistisch. Vielmehr erreichen Gesellschaften verschiedene Grade von Sozialismus – gemessen daran, wie weitreichende Teile des Alltagslebens dem Markt und der Verfügung privater Interessen entzogen sind, wie demokratisch Eigentum und gesellschaftliches Leben organisiert sind und wie handlungsfähig die große Klasse der Lohnabhängigen gegenüber der kleinen Klasse der Kapitalbesitzer ist.
Bestehende Institutionen weisen in Richtung des Sozialismus, wenn sie der arbeitenden Klasse Macht verschaffen und die Verfügungsgewalt des Kapitals einschränken, Güter dem Markt entziehen und Eigentum demokratisieren. Institutionen des Wohlfahrtsstaats, des öffentlichen und Kooperativsektors, gewerkschaftlicher Mitbestimmung und intervenierender Industriepolitik sind in diesem Sinne Ansätze demokratischer Kontrolle über wirtschaftliche Prozesse. Sie bilden Vorposten einer Logik des Lebens und Wirtschaftens, die nicht private Profite, sondern sozialen Reichtum verfolgt.
Sozialistische Reformen müssen diese Ansätze vertiefen und immer weitere Sphären des gesellschaftlichen Lebens nach Grundsätzen der Gleichheit und der sozialen Rechte organisieren. Doch wie Gorz und Miliband klarstellen, kann dies nur gelingen, wenn wir Reformen nicht technokratisch als das Fixen von Problemen oder als ein »Etwas Mehr« von Rente, Mindestlohn oder Hartz IV verstehen, sondern als Schachzüge in einem andauernden gesellschaftlichen Konflikt, welche die Bedingungen für die eigene Seite strukturell verbessern sollen.

Sich weniger erpressbar machen
Es kommt darauf an, einerseits die Arbeitenden sozial und politisch zu stärken und andererseits die Besitzenden sozial und politisch zu schwächen. Die Verhandlungsposition der allermeisten Arbeitenden ist in zweierlei Hinsicht schlecht. Einerseits hängt ihr Job und damit ihr Lebensunterhalt von den fortgesetzten Profiten des sie beschäftigenden Unternehmens und seiner Eigentümer ab. Andererseits bedeutet der Verlust des Arbeitsplatzes sozialen Abstieg. Das führt dazu, dass Beschäftigte schlechte Arbeitsbedingungen hinnehmen, Überstunden nicht aufschreiben, stagnierende Löhne akzeptieren und nicht gegen sexistische und übergriffige Chefs aufmucken.
Zudem führt das ungleiche Maß der Erpressbarkeit zu Konkurrenz unter den Arbeitenden. Die Mittelklasse der höher Qualifizierten hat eine größere Verhandlungsmacht, weil ihre Fertigkeiten schwerer ersetzbar sind. Durchschnittlich qualifizierte Arbeitende und vor allem die Geringqualifizierten – unter ihnen viele Migrantinnen und Migranten –, haben hingegen viel weniger Spielraum. Alle möglichen Formen von Herrschaft sind hier zu einem Knoten verschlungen.
Herkömmliche Reformen setzen an den Symptomen dieser Missverhältnisse an, indem sie etwa Lohndifferenzen durch Besteuerung und Umverteilung nachträglich abmildern, eine untere Grenze der Löhne festsetzen und damit die Konkurrenz abschwächen oder bestimmte Formen der Diskriminierung strafrechtlich verfolgen. All das ist gut und wichtig. Doch es löst den Knoten nicht, weil die Arbeitenden grundsätzlich erpressbar bleiben.
Eine Reform, die die Position der Arbeitenden grundsätzlich verbessern würde, ist eine Jobgarantie, wie sie unter anderem von der Ökonomin Pavlina Tcherneva ausgearbeitet wurde. Nach diesem Vorschlag, der das Menschenrecht auf Arbeit umsetzen würde, soll der Staat allen, die dies wollen, einen sinnvollen Arbeitsplatz zu einem armutsfesten Mindesteinkommen anbieten (ohne sozialstaatliche Leistungen von dieser Arbeit abhängig zu machen). Der Effekt einer Durchsetzung von Mindeststandards bei Jobqualität und Entlohnung ähnelt dem des Mindestlohns. Darüber hinaus wären die Arbeitenden aber auch viel weniger erpressbar, wenn als Alternative zu ihrer derzeitigen Anstellung nicht Arbeitslosigkeit, sondern ein sinnvoller, vernünftig entlohnter Job im öffentlichen Beschäftigungssektor wartet.
Nach diesem Vorschlag wäre die Schaffung und Ausgestaltung der Jobs außerdem Bürgerinnenräten auf kommunaler Ebene unterstellt. Das würde der lokalen Bevölkerung einen viel größeren demokratischen Einfluss darauf geben, welche Art von Tätigkeiten in ihrem Nahumfeld ausgeführt werden. Bedarfe, nicht Profite wären entscheidend bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Jobgarantie ist damit ein Beispiel für eine nicht-reformistische Reform. Denn sie erhöht die Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen, verschiebt damit die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen, und ermöglicht zugleich der lokalen Bevölkerung, unabhängig vom Markt und privaten Profitinteressen demokratisch über ihre wirtschaftlichen Prioritäten zu entscheiden.

Öffentlicher Reichtum
Doch auch mit garantierten Jobs verbliebe der Besitz an Großunternehmen immer noch bei einer winzigen Schicht von Besitzenden – in Deutschland meist windigen Familienclans mit Grundbesitz und Nazivergangenheit. Die Privatisierungen der letzten Jahrzehnte, Steuerprivilegien und Subventionen haben den Reichtum dieser Schicht exorbitant ansteigen lassen. Ihre Investitionsentscheidungen sind prägend für die gesamte Gesellschaft, unterliegen aber keiner demokratischen Kontrolle.
Dieses Ende des Knotens können Reformen zur Demokratisierung des Unternehmensbesitzes und zur Ausweitung des öffentlichen Reichtums lockern. Zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge – wie das Wohnen oder die Energieversorgung – müssen kommunalisiert und der Spekulation und Renditeorientierung entzogen werden. Die Stärkung der öffentlichen Hand gegenüber dem privaten Eigentum sichert die Bereitstellung öffentlicher Güter, mindert Konkurrenz und Preisdruck und ermöglicht demokratische Teilhabe.
Anders als bei Modellen der Verstaatlichung, bei denen die Riege der Unternehmenseigner lediglich durch ein Gremium von Technokraten abgelöst wird, besticht das Konzept öffentlichen oder kommunalen Eigentums vor allem durch die Miteigentümerschaft der Menschen selbst. Diese kann dort ansetzen, wo die Menschen leben, oder dort, wo sie arbeiten. So könnten etwa große Unternehmen dazu verpflichtet werden, Kapitalbeteiligungsfonds für ihre Belegschaften einzurichten. Jedes Jahr würde ein Bruchteil der Kapitalanteile an Fonds übertragen, deren Vorstände direkt von den Beschäftigten gewählt werden. Dann säßen diejenigen, deren Arbeit das eigentliche Kapital der Firmen ist, mit am Tisch, wo die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen werden: auf den Hauptversammlungen.
Miteigentümerschaft hat auch den Effekt, dass Investitionen und Gewinne in sozial nützlichere Kanäle geleitet werden. Ein Beispiel hierfür ist die Windenergie, die derzeit von Rechten als Quelle ländlichen Protestpotenzials ausgeschlachtet wird. Ein Teil des Unmutes in der Landbevölkerung über den Bau neuer Windräder kommt daher, dass der erzeugte Strom in erster Linie anderswo genutzt wird und die verantwortlichen Privatunternehmen vor Ort keine oder nur wenige Jobs schaffen. Wären Windräder hingegen kommunales Eigentum, über deren Ertrag demokratische Gremien vor Ort mitentschieden, stiege auch die Akzeptanz für den notwendigen ökologischen Umbau der Kommunen.
Je direkter ein Sektor von den Arbeitenden oder Anwohnern selbst mitverwaltet wird, desto eher werden Lösungen gefunden, die Legitimität in der Bevölkerung genießen. Und desto schwieriger ist es für den politischen Gegner, öffentliches Eigentum wieder zu privatisieren. Vergesellschaftungen auf lokaler oder Unternehmensebene sind politisch nachhaltiger als unpersönliches Staatseigentum, bei dem schwer fassbar ist, inwiefern es sich um den kollektiven Besitz der Menschen handelt. Institutionalisierte Ansprüche auf politische und wirtschaftliche Teilhabe, welche die Leute nicht so einfach wieder hergeben, sind ein entscheidendes Element nicht-reformistischer Reformen. Sozialistische Reformen sind also umso stärker, je intensiver und lokaler sie Menschen in Entscheidungen und Eigentum einbinden.
Dass die Zurückdrängung der Kapitalmacht durchaus auch im Kleinen anfangen kann, zeigt das Beispiel der britischen Modellregion Preston, einer deindustrialisierten und vormals wirtschaftlich abgehängten Kleinstadt in England. Diese praktiziert heute erfolgreich Community Wealth Building, also den Aufbau öffentlichen Reichtums auf kommunaler Ebene. Die Stadt und eine kommunale Förderbank in öffentlicher Hand fördern die Gründung von Arbeiterkooperativen und gemeinnützigen Community Land Trusts, die inklusiven und nicht-spekulativen Land- und Immobilienbesitz organisieren. Diese und andere Unternehmen, die hohe Arbeitsstandards einhalten, werden bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und in den Geschäftspraktiken öffentlicher Ankerinstitutionen wie Krankenhäusern und Fachhochschulen bevorzugt. Ökonomisches Wachstum kommt so der Allgemeinheit zugute und wird öffentlich und vor Ort genutzt, statt aus den Kommunen abzufließen und in privaten Taschen zu landen.
Eine solche Modellregion operiert im Kleinen schon nach den Prinzipien, die eine sozialistische Demokratie im Großen auszeichnen. Statt nachträglich die Ungleichheit zu korrigieren, die die kapitalistische Eigentumsstruktur unweigerlich mit sich bringt, dringt diese an den Kern der ökonomischen Beziehungen vor und verwandelt ihn im Interesse der Allgemeinheit. Das Ergebnis kann eine gemischte Ökonomie sein, in der der öffentliche Sektor gegenüber dem Privatsektor dominant ist und die Kontrolle über das Eigentum immer weiter demokratisiert wird.
Die Ausdehnung des öffentlichen Eigentums kommt dabei auch der staatlichen Fähigkeit zugute, kapitalistischen Wirtschaftsinteressen zu Kompromissen zu zwingen. Álvaro García Linera, der ehemalige Vizepräsident von Bolivien, spricht aus Erfahrung, wenn er sagt: »Der Schlüsselmoment für eine progressive Regierung ist der Zeitpunkt, an dem sie über so viel ökonomische Stärke verfügt, dass sie nicht mehr von größeren Wirtschaftsakteuren in die Mangel genommen werden kann. Dazu muss der Staat 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kontrollieren. Dann kann er der Privatwirtschaft aus einer Position der Macht anstatt der Unterordnung begegnen.«

Think Tanks reichen nicht
Eigentum, Vermögen, soziale Rechte und die Kontrolle über den Arbeitsprozess – sie alle bezeichnen Hebelpunkte der bestehenden Ordnung. Punkte, an denen sich bestimmt, wer über Macht und Ressourcen verfügt und wer nicht, wer was zu sagen hat und wer stumm bleibt. Sozialistische Reformen greifen hier ein und verschieben Kräfteverhältnisse, indem sie die Abhängigkeit normaler Menschen von ihrer Marktsituation verringern und breite demokratische Kontrolle über die Bedingungen unseres Alltagslebens organisieren. Wie der Rechts- und Kulturwissenschaftler Jedediah Purdy es ausdrückt, bedeutet Sozialismus, »das Gedeihen und die materielle Absicherung des einfachen, ganz gewöhnlichen Lebens in den Mittelpunkt der politischen Ökonomie zu stellen.«
Gorz und Milibands Gedanken zu nicht-reformistischen Reformen und revolutionärem Reformismus sind hilfreich für diese Vorhaben, weil sie zeigen, wie wir den Knoten kapitalistischer Herrschaft von verschiedenen Enden lösen können. Heute werden nicht-reformistische Reformen vorwiegend von Think Tanks wie dem britischen Common Wealth, der New Economics Foundation oder dem US-amerikanischen People’s Policy Project erdacht und diskutiert. Trotz großen Potenzials wartet der deutschsprachige Raum noch auf Institutionen dieser Art, die sich voll und ganz dem Entwerfen transformativer Reformen verschreiben. Dabei könnte die politische Linke hier aus den Stärken ihrer vielfältigen sozialen Basis schöpfen: der universitär ausgebildeten Intelligenz und dem Organisationswissen und politischen Sinn von Arbeitenden und ihren Interessenorganisationen.
Selbstverständlich ersetzen auch radikale Policy-Vorhaben nicht den Aufbau politischer Macht. Die besten Ideen sind Papiertiger, wenn es keine glaubwürdigen Kräfte gibt, die sie popularisieren und ihnen Wirksamkeit verschaffen. Doch würden sozialistische Kräfte in den Parteien links der Mitte sowie den Gewerkschaften entscheidend gestärkt, könnten sie mit einem Kanon ebenso radikaler wie machbarer Reformen in die Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern gehen.
Dafür müssen wir im Hier und Jetzt die Hebel ausmachen, die umzulegen sich wirklich lohnen würde. Wenn die nächste Krise die Arbeitslosenzahlen wieder in die Höhe treibt, müssen Sozialistinnen mit einem durchdachten und klar verständlichen Konzept einer Jobgarantie bereitstehen. Wenn Entlassungen in der Industrie drohen, sollten es Sozialisten sein, die gemeinsam mit den Gewerkschaften nicht nur Arbeitsplätze verteidigen, sondern strategisch darum ringen, die Handlungsmacht der Arbeitenden zu vergrößern.
Sozialistische Reformen sind keine Reparatur der bestehenden Gesellschaft und erst recht keine Prophylaxe gegen sozialen Protest. Sie zielen nicht auf gradualistisch-konfliktloses Social Engineering von oben, sondern auf eine Rückeroberung von gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit. Sie identifizieren, wie Macht und Machtlosigkeit von der institutionellen Struktur unserer Gesellschaft produziert werden. Und sie machen aus, wie diese verändert werden kann, um weitere Schritte in Richtung Demokratie und Gleichheit zu erleichtern. Sozialistische Reformen beschreiben eine Strategie der großen Schritte.
Linus Westheuser ist Jacobin-Redakteur und Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Er tweetet unter @LWestheuser.
Linus Westheuser ist Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin und Contributing Editor bei JACOBIN.