15. April 2022
Freiheit in Dosen
Albanien wollte Freiheit und bekam eine Schocktherapie. Lea Ypi erzählt vom Untergang des Staatssozialismus, der ihr Zuhause war.

An dem Abend, an dem ich Lea Ypis brillantes und bewegendes neues Buch Frei: Erwachsenwerden am Ende der Geschichte fertig las, traf ich mich mit zwei Serbinnen in ihren späten Vierzigern in einer berühmten Belgrader Pizzeria. Wie Ypi waren auch sie Jugendliche gewesen, als der europäische Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts in seinen letzten Zügen lag. Als das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen waren, implodierte, ging die eine noch auf die Sekundarschule, die andere studierte schon im ersten Semester an der Universität.
Die jüngere der beiden Frauen, die inzwischen mehr als zwanzig Jahre im Westen verbracht hatte, berichtete bei einem Glas Orangina: »Ich war in Novi Sad, als der Krieg begann. Mein Vater war 49, gerade noch jung genug, um eingezogen zu werden. Er sollte die Einberufungsbescheide an die Männer in unserer Nachbarschaft ausliefern, aber er schaffte es einfach nicht.«
»Die meisten Jungen aus meiner Klasse gingen zur Armee«, sagte die zweite Frau. »Sie wurden einfach mit dem Hubschrauber mitten im Nirgendwo abgesetzt, mit Kalaschnikows. Viele sind nicht wieder zurückgekehrt.« Die erste Frau fuhr fort: »Es geschah alles so schnell. Wir begannen, unsere Freunde umzubringen. Das war nicht die Freiheit, auf die wir gehofft hatten.«
Während unseres Abendessens teilten sie Anekdoten aus ihrem früheren Leben, das durch den plötzlichen Zusammenbruch des Sozialismus in zwei Hälften geteilt wurde. Als Ethnografin Osteuropas habe ich in den letzten drei Jahrzehnten mit Hunderten von Menschen verschiedene Versionen dieses Gesprächs geführt. Die anfängliche Euphorie über eine Zukunft mit freien Wahlen und einer neuartigen Fülle von Konsumgütern wich allmählich Ernüchterung, Enttäuschung und Verzweiflung.
Ob der Auftakt der »Freiheit« nun ethnische Konflikte und Völkermord nach sich zog wie im Falle Jugoslawiens, politischen Zusammenbruch und Bürgerkrieg wie im Falle Albaniens, oder massive soziale Verwerfungen, Arbeitslosigkeit und Armut wie in fast allen anderen ehemals sozialistischen Ländern – in jedem Fall leiteten die hehren Ideale der Freiheit eine Ära tiefgreifender Unsicherheit und umfassenden Leids für viele Menschen ein.
Fukuyama an der Adria
Lea Ypis Buch, halb Memoiren, halb Bildungsroman, erzählt eine sehr persönliche Geschichte des Sozialismus und Postsozialismus. Wir lernen die Protagonistin kennen, ein Mädchen, das sich an die Bronzebeine einer kopflosen Stalin-Statue klammert, als die Demokratie-Proteste in ihrer Heimatstadt Durrës in Albanien ausbrechen.
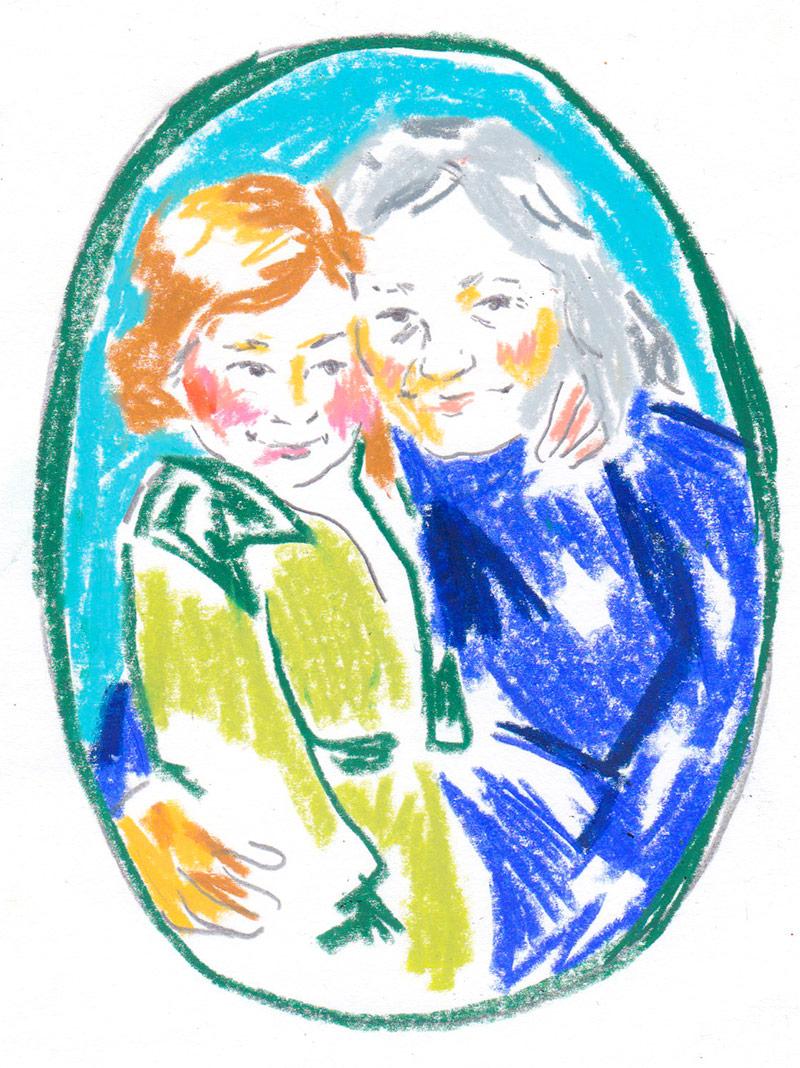
Ähnlich wie Jana Hensels 2002 erschienene Memoiren Zonenkinder, die von ihrer Kindheit und Jugend in Ostdeutschland erzählen, spiegeln auch Ypis Reflexionen über die Stabilität und Behaglichkeit ihrer jugendlichen marxistischen Weltanschauung die Erfahrungen von Hunderten Millionen Menschen, deren gesamtes Leben durch die Ereignisse nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 schlagartig auf den Kopf gestellt wurde. Das »Ende der Geschichte« im Untertitel bezieht sich auf Francis Fukuyamas kühne Behauptung, die Niederlage des Kommunismus im Kalten Krieg markiere »den Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit und die Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie als endgültige Form der menschlichen Regierung«.
Ypi scheut sich nicht, das ehemalige albanische Regime zu kritisieren, das auch ihre eigenen Familienmitglieder verfolgte, die ihr ganzes Leben lang von ihren falschen »Biografien« heimgesucht wurden. Sie verfällt jedoch nicht in den simplifizierenden, reflexartigen Antikommunismus, der so viele andere Memoiren von Kindern und Enkeln der enteigneten Bourgeoisie kennzeichnet. Ypi verurteilt das autoritäre Regime, unterzieht aber auch die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Prozesse, welche den Anbruch der Demokratie in den 1990er Jahren bestimmten, einer kritischen Betrachtung.
»Coca-Cola-Dosen und Kaugummiverpackungen aus dem Westen wurde ein völlig übersteigerter Wert beigemessen.«
Die Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie ging mit der Durchsetzung »freier« Märkte und der Umsetzung einer »Schocktherapie« einher – einem neoliberalen Reformpaket, das die ehemals sozialistischen Länder rapide in die globale kapitalistische Wirtschaft integrieren sollte. Ypi schreibt:
»Der Begriff stammt aus der Psychiatrie. Bei einer Schocktherapie werden elektrische Impulse durch das Gehirn des Patienten geschickt, um die Symptome einer schweren psychischen Erkrankung zu lindern. In unserem Fall galt die Planwirtschaft als das Äquivalent zur Geisteskrankheit. Das Heilmittel war eine transformative Geldpolitik: Haushalte ausgleichen, Preise freigeben, staatliche Subventionen streichen, den Staatssektor privatisieren und die Wirtschaft für Außenhandel und Direktinvestitionen öffnen. Der Markt würde sich von selbst regulieren, und die sich herausbildenden kapitalistischen Institutionen würden auch ohne eine zentrale Steuerung effektiv arbeiten. Die Krise zeichnete sich ab, aber die Menschen hatten im Namen einer besseren Zukunft ihr Leben lang Opfer gebracht. Dies sei die letzte Anstrengung, die man ihnen abverlangen würde. Mit drastischen Maßnahmen und gutem Willen würde der Patient sich nämlich schnell von dem Schock erholen und die Vorteile der Therapie genießen können.«
In Albanien hatte die Schocktherapie verheerende Folgen. Ypi schildert, wie das soziale Gefüge ihrer Kindheit – die Solidarität und der Gemeinschaftssinn, welche die Unterdrückung durch das kommunistische Regime erträglich machten – unterging, als sich der ungehemmte Unternehmergeist des Kleptokapitalismus ausbreitete. Im Laufe eines Prozesses, den sie als »Privatisierung von unten nach oben« bezeichnet, werden ganze Wälder abgeholzt, Babys in Waisenhäusern zurückgelassen, Mädchen nach Italien verschleppt und viele ihrer Landsleute, welche die Adria in Booten zu überqueren versuchen, versinken im Meer: »Jahrzehntelang hatte der Westen den Osten für die geschlossenen Grenzen kritisiert, Kampagnen für mehr Freizügigkeit finanziert und Staaten als unmoralisch verurteilt, die ihren Bürgern die Ausreise erschwerten. Die Exilanten waren empfangen worden wie Helden. Nun behandelte man sie wie Kriminelle.«
Das Schlimmste war aber, dass Hunderttausende Familien aufgrund einer Reihe von Schneeballsystemen ihre gesamten Ersparnisse verloren, darunter auch die Familie von Ypi. An dieser Krise entzündete sich 1997 der albanische Bürgerkrieg.
Angesichts dieser Verwerfungen ist es bemerkenswert, dass zwischen 1995 und 1998 noch 24,3 Prozent der Albanerinnen und Albaner der Meinung waren, dass man »den meisten Menschen vertrauen« könnte. Als die World Values Survey zwischen 2017 und 2020 – nach mehr als zwanzig Jahren der Versuche, eine sogenannte Zivilgesellschaft aufzubauen – dieselbe Frage erneut stellte, dachten das nur noch unter 3 Prozent der Bevölkerung.
Freie Wahl?
Ypi blickt nicht nostalgisch auf ihre Kindheit zurück und romantisiert die Vergangenheit auch nicht. Dennoch drängt sich in ihrer kraftvollen Erzählung die Frage auf, ob Atomisierung und Isolation die unvermeidlichen Nebenprodukte eines Systems sind, das von privatem Profit und individuellen Freiheiten besessen ist. So schreibt die Künstlerin und Schriftstellerin Swetlana Bojm in ihrem weitsichtigen Buch Another Freedom: The Alternative History of an Idea von 2010:
»Die Erfahrung der Freiheit wurde im Verlauf der Geschichte und in verschieden Kulturen unterschiedlich bewertet. Noch heute steht die Freiheit in einem Missverhältnis zu anderen höchst erstrebenswerten Zuständen wie Glück, Zugehörigkeit, Ruhm oder Intimität. Während diese Zustände Einheit und Verschmelzung suggerieren, hat die Freiheit ein Element von Entfremdung, das die Auseinandersetzung mit anderen in der Öffentlichkeit nicht per Definition ausschließt, sie aber weniger berechenbar macht.«
Wie Bojm fragt auch Ypi auf einer grundsätzlichen Ebene, was es bedeutet, frei zu sein. Ursprünglich sollte ihr Buch »ein philosophisches Werk über deckungsgleiche Vorstellungen von Freiheit aus den beiden Traditionen sein, der liberalen und der sozialistischen«, doch dann merkte sie, dass verschiedene Mitglieder ihrer Familie diese Vorstellungen personifizierten. Dennoch verbirgt sich hinter der leichtfüßigen Prosa ihrer Erinnerungen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit bestimmten idealisierten Vorstellungen von Freiheit. Schließlich wurden sie denjenigen Menschen zum Verhängnis, deren Leben durch den weitgehend unerwarteten Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa in zwei gerissen wurde.
Ypi stellt fest: »Die Freiheit wird nicht erst dann geopfert, wenn andere uns vorschreiben, was wir sagen, wohin wir gehen und wie wir uns verhalten sollen. Eine Gesellschaft, die von sich behauptet, jedes ihrer Mitglieder könne sein Potenzial entfalten, die es aber nicht schafft, jene Strukturen zu ändern, die einen Teil dieser Mitglieder vom Erfolg fernhalten, ist ebenfalls repressiv.«
Ypis Bedenken erinnern an die Arbeit des indischen Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen, der argumentiert, dass ökonomische Entwicklung immer auch auf die Ausweitung sozialstaatlicher Programme abzielen muss, damit sich die Menschen entfalten können. Die Fokussierung von Entwicklungsprogrammen auf das Wachstum des Bruttosozialprodukts oder die Modernisierungsrate lokaler Industriekapazitäten sei unzulänglich, da wahre menschliche Freiheit bestimmter sozialer Garantien bedarf:
»Obwohl der Überfluß insgesamt in nie gekannter Weise zunimmt, werden einer großen Anzahl – vielleicht sogar der Mehrheit – der Menschen in der heutigen Welt elementare Freiheiten vorenthalten. Manchmal geht der Mangel an substantieller Freiheit unmittelbar mit wirtschaftlicher Armut einher, die den Menschen die Freiheit nimmt, ihren Hunger zu stillen, sich gesund zu ernähren, Medizin für heilbare Krankheiten zu bekommen, sich geeignete Kleidung und Unterkunft zu verschaffen oder über sauberes Wasser und sanitäre Anlagen zu verfügen. In anderen Fällen ist Unfreiheit eng mit dem Fehlen öffentlicher Einrichtungen und sozialer Fürsorge verknüpft, etwa mangelhafte Seuchenprävention, kein organisiertes Gesundheitswesen, fehlende Bildungsanstalten oder starke Institutionen, die Frieden und Ordnung lokal aufrechterhalten können.«
»Ypi schreibt vom selbstverständlichen Gemeinsinn, mit dem man sich gegenseitig die Plätze in langen Warteschlangen für rationierte Waren freihielt.«
Ypis Erinnerungen an ihre Kindheit im isolierten, stalinistischen Albanien zeigen, dass das Regime zwar bürgerliche Freiheitsrechte brutal unterdrückte, jedoch viele der sozialstaatlichen Programme bereitstellte, die Sen zufolge notwendig sind, um die menschliche Entfaltung voranzubringen. Wenn man genau hinschaut, dokumentiert Ypi, wie wenig ihre Kindheit von Mangel gekennzeichnet war, während sie zugleich hervorhebt, dass etwa leeren Coca-Cola-Dosen und Kaugummiverpackungen aus dem Westen ein völlig übersteigerter Wert beigemessen wurde.
Trotz der extremen Indoktrination erhielt Ypi eine umfassende Grund- und Sekundarschulbildung. Selbst ihr Vater, der aufgrund seiner Familiengeschichte nicht Mathematik studieren durfte, absolvierte eine höhere Ausbildung an einer staatlichen Universität für Forstwirtschaft. Ypi beschreibt zwei glückliche Wochen, die sie in einem Pionierlager verbrachte, sie erzählt von ihrem gemütlichen Zuhause (in dem sie allein in ihrem eigenen Schlafzimmer weint), von den freundschaftlichen Verhältnissen in der Nachbarschaft und dem selbstverständlichen Gemeinschaftssinn, mit dem man sich gegenseitig die Plätze in langen Warteschlangen für rationierte Waren freihielt.
Ein funktionierendes öffentliches Verkehrssystem sowie die relative Autonomie ihrer Mutter bilden die Kulisse, vor der sich Ypis Erzählung entfaltet. Ihre Mutter war im Alter von 22 Jahren nationale Schachmeisterin und betonte oft, »es gäbe bezüglich unseres kommunistischen Erbes nur eine Sache, auf die wir stolz sein könnten: dass die Partei eine strikte Gleichbehandlung der Geschlechter durchgesetzt hatte, ohne jegliche Zugeständnisse; dass Erwerbstätigkeit von allen erwartet wurde, Männern wie Frauen. Nicht bloß, dass den Frauen alle Berufe offenstanden; sie wurden sogar aktiv ermutigt, sie zu ergreifen«.
Ihrem Vater, der unter schwerem Asthma litt, fehlte es nie an den notwendigen Medikamenten, um seine Symptome zu lindern. Ypi selbst, die als Frühchen zur Welt kam, verbrachte längere Zeit in einem Inkubator im Krankenhaus, ohne dass das ihre Familie mit astronomischen Arztrechnungen in den Ruin trieb.
Verlorene Zukünfte
Sind die Bedingungen der Freiheit erfüllt, wenn man in einem Mehrparteiensystem wählen gehen darf, aber zugleich materielle Umstände, auf die man keinen Einfluss hat, entscheiden, was man für ein Leben führen wird? Ypi zwingt uns, diese Frage zu stellen. »Worin müssen wir uns sicher sein, um die Unsicherheit auszuhalten?«, fragte Swetlana Bojm schon 2010. »Wie viel gemeinsame Grundlage oder gegenseitiges Vertrauen braucht es, um die ungewöhnlichen Erfahrungen der Freiheit zu ermöglichen?« Ypi reflektiert dieses Dilemma, indem sie den »Selbstmord« ihres Landes in den 1990er Jahren dokumentiert. Ohne eine zuverlässige Absicherung aller Grundbedürfnisse, ohne eine gewisse Stabilität und Sicherheit, ist das abstrakte liberale Konzept der Freiheit möglicherweise bedeutungslos.
»Ihr Sozialismus zeichnete sich durch den Triumph von Freiheit und Gerechtigkeit aus, meiner durch sein Scheitern.«
Für Leserinnen und Leser dieses Magazins dürften das letzte Kapitel und der Epilog des Buches von besonderem Interesse sein. Ypi kritisiert hier die Blindheit und Ignoranz westlicher Sozialistinnen und Sozialisten, die nicht anerkennen wollen, dass die staatssozialistischen Experimente des 20. Jahrhunderts in so unterschiedlichen Ländern wie der DDR, China, Kuba, Vietnam, Jugoslawien oder Albanien manche Sachen richtig gemacht haben und einige wertvolle Lehren bereithalten. In deren Augen hatten diese Experimente »nichts Sozialistisches« an sich: »Man betrachtete sie als die verdienten Verlierer eines historischen Wettstreits, in den der wahre, echte Titelanwärter erst noch eintreten musste. Der Sozialismus meiner Freunde war klar, hell und in der Zukunft. Meiner war chaotisch, blutig und aus der Vergangenheit.«
Eine der größten Freiheiten, die die Menschen in Osteuropa nach 1989 erlangten, war die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen und auszuwandern. Wie so viele andere junge Albanerinnen und Albaner flieht auch Ypi aus ihrem Land, um in Italien und Großbritannien eine bessere Lebensperspektive und höhere Bildung zu finden. Sie hat auch das Glück, dass ihrer Familie ein Küstengrundstück wiedererstattet und anschließend an einen »arabischen Immobilienentwickler« verkauft wird, wodurch sich ihre finanzielle Situation schlagartig verbessert. Sie wird Postdoktorandin in Oxford und Professorin an der London School of Economics, wo sie Kurse über marxistische Theorie gibt und an Lesegruppen teilnimmt, die das Kapital durcharbeiten.
Ypi teilt mit uns ihre Frustration über ihre westlichen Genossinnen und Genossen, die reflexartig die Relevanz der Erfahrungen derjenigen abtun, die im »real existierenden Sozialismus« aufgewachsen sind:
»Die Zukunft, die sie anstrebten und die die sozialistischen Staaten einst verkörpert hatten, griff auf dieselben Bücher, dieselbe Gesellschaftskritik und dieselben historischen Figuren zurück. Nur dass sie diesen Umstand zu meiner Überraschung als unglücklichen Zufall betrachteten. Alles, was auf meiner Seite der Welt schiefgelaufen war, ließ sich mit der Grausamkeit unserer Anführer erklären oder mit der einzigartigen Rückständigkeit unserer Institutionen. Meine Freunde glaubten, nur wenig daraus lernen zu können. Es bestand keine Gefahr, alte Fehler zu wiederholen, kein Grund, über das Erreichte nachzudenken oder darüber, warum es zerstört wurde. Ihr Sozialismus zeichnete sich durch den Triumph von Freiheit und Gerechtigkeit aus, meiner durch sein Scheitern. Ihr Sozialismus würde von den richtigen Leuten mit den richtigen Motiven zustande gebracht, unter den richtigen Umständen und mit der richtigen Mischung aus Theorie und Praxis. Meiner war einfach nur – zum Vergessen.«
Der Zweite Weg
Ypi hat völlig Recht, dass diejenigen, die sich heute für den Aufbau einer gerechteren, gleichberechtigteren und nachhaltigeren Zukunft einsetzen, die früheren Versuche sozialistischer Gesellschaften ernst nehmen müssen: die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren, die schlechten Entscheidungen, die sie getroffen haben, und die Gründe, die sie scheitern ließen. Ebenso wichtig ist es aber, »über das Erreichte nachzudenken«.
In Albanien zum Beispiel waren vor der Einführung des Sozialismus im Jahr 1945 die meisten Frauen Analphabetinnen. Doch schon 1955 konnten alle Menschen unter vierzig Jahren lesen und schreiben. In den 1980er Jahren, als Ypi noch ein Kind war, waren die Hälfte aller Studierenden an den Universitäten Frauen. 1945 lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Albanien bei gerade einmal vierzig Jahren – 1990 war dieser Wert auf siebzig Jahre angestiegen.
Dies war zum Teil das Ergebnis der massiven Anstrengungen, welche die kommunistische Staatsführung zur Senkung der Kindersterblichkeitsrate unternahm. 1945 erlebten 302 von 1.000 in Albanien geborenen Kindern ihren fünften Geburtstag nicht. 1990 starben nur noch 46 von 1.000 im frühen Kindesalter. Zwar ist die Kindersterblichkeit in Albanien auch in den letzten dreißig Jahren weiter gesunken, jedoch müssen wir anerkennen, dass die sozialstaatlichen Programme, die notwendig waren, um die Gesundheit und das Wohlergehen der zukünftigen Generationen zu gewährleisten, ursprünglich von einem repressiven autoritären Regime eingeführt wurden.
»Während Albanien für viele, die sich dem Regime widersetzten, tatsächlich ein ›Freiluftgefängnis‹ darstellte, war es für andere, wie die junge Ypi, einfach ihr Zuhause.«
Solche Statistiken lassen sich für viele der ehemals sozialistischen Länder anführen. Was Ypis Buch so besonders macht, ist aber gerade, dass sie uns nicht zu belehren versucht, sondern die Erzählung für sich sprechen lässt, ohne sie mit politischen Nebenbemerkungen zu überfrachten. Das Leben in sozialistischen Ländern wird oftmals als ein langer Albtraum des Totalitarismus mit Hungersnöten, Säuberungen und Gulags dargestellt. Ypi offenbart uns, wie gewöhnlich ihr Leben im Sozialismus war, samt all der üblichen Ereignisse und Gepflogenheiten, die das Erwachsenwerden kennzeichnen: für Prüfungen pauken, sich um Noten sorgen, Outfits für Abschlussfeiern aussuchen, von seinem Schwarm träumen und darüber fantasieren, was man einmal werden will.
Während Albanien für viele, die sich dem Regime widersetzten oder die falschen Biografien hatten, tatsächlich ein »Freiluftgefängnis« darstellte, war es für andere, wie die junge Ypi, einfach ihr Zuhause. Als die Regime des Staatssozialismus plötzlich zusammenbrachen und Armut, Vertreibung, Kriminalität, Korruption, Bürgerkrieg oder Völkermord um sich griffen, wurde das menschliche Leid, das mit dem sogenannten Übergang verbunden war, von den westlichen Eliten weitgehend ignoriert. Diese interessierten sich nur dafür, als Sieger aus dem »Ende der Geschichte« hervorzugehen, indem sie ihre Märkte expandierten und ihre Produktionsstätten in Länder mit qualifizierten, aber billigen Arbeitskräften auslagerten.
Als ich an diesem Abend durch die belebten Straßen Belgrads nach Hause ging, vorbei an den hell erleuchteten Schaufenstern westeuropäischer Ladenketten wie DM, Zara, Deichmann oder H&M, dachte ich über Ypis Buch nach, über die Lebensgeschichten der beiden Frauen, mit denen ich gegessen hatte, und über ihre spürbare Unzufriedenheit mit der Erinnerungspolitik, die dieser Vergangenheit gilt, welche sie selbst durchlebt hatten. Ich erinnerte mich an etwas, das Slavoj Žižek 1999 geschrieben hatte, als die NATO-Truppen während des Kosovokriegs Serbien und Montenegro bombardierten.
Žižek äußerte damals die Hoffnung, dass sich aus der Asche des Kommunismus in Osteuropa ein neues politisches und ökonomisches System erheben würde – nicht nur ein Kapitalismus mit menschlichem Antlitz, eine zahnlose Version der Sozialdemokratie, die als Dritter Weg bezeichnet wurde, sondern eine echte Alternative. Er argumentierte, dass diese neue utopische Vision, die er den »Zweiten Weg« taufte, am ehesten in den Köpfen derjenigen entstehen würde, die sowohl den Sozialismus als auch die liberale Demokratie erlebt und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile kennengelernt hatten.
Vielleicht kann Ypis ergreifendes und zeitgemäßes Buch einen dringend notwendigen Ost-West-Dialog darüber anregen, wie wir uns dem liberalen Freiheitsbegriff und seiner Mitschuld an der ungehaltenen, grausamen Habgier des globalen Kapitalismus widersetzen können.
Kristen Ghodsee ist Professorin für Russland- und Osteuropastudien an der University of Pennsylvania und Autorin von zwölf Büchern, darunter Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben und Utopien für den Alltag: Eine kurze Geschichte radikaler Alternativen zum Patriarchat.