13. Juni 2021
Geld arbeitet nicht
Vom Grundeinkommen über Klimaschutz bis zur Staatsverschuldung – unsere ökonomischen Debatten laufen oft ins Leere, weil wir diesen einen Punkt nicht verstehen.
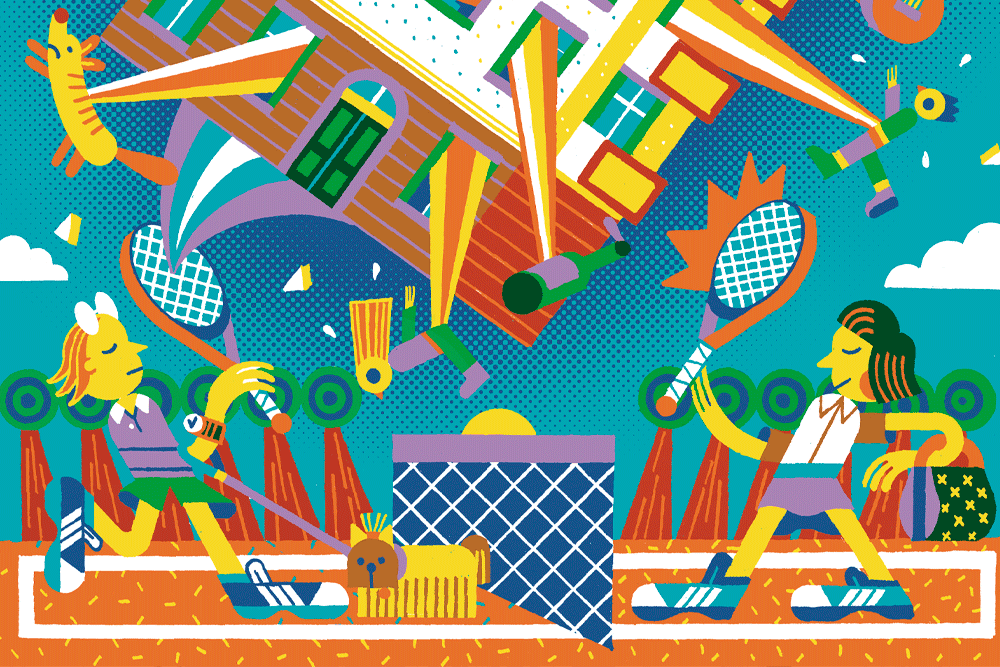
ILLUSTRATION Anton Ohlow
Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten« – so lautet das Glücksversprechen aller Finanzberater, seien sie seriös oder dubios, online oder offline. Die finanzielle Unabhängigkeit von Lohnarbeit ist für Normalsterbliche eine fast paradiesische Vorstellung. Nicht bis zur Rente warten zu müssen, um mit der täglichen Plackerei aufhören zu können, ist verlockend. Aber die Sache ist die: Geld arbeitet nicht. Nie. Auch dann nicht, wenn man es »sinnvoll investiert«.
Dennoch ist diese Vorstellung weit verbreitet und wirkungsmächtig. Das zeigte sich zuletzt an den beipflichtenden Reaktionen, als das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel für nichtig erklärte: Den Vermieterinnen und Vermietern stünden ihre hohen Profite zu, schließlich würden sie in nobler Selbstaufgabe darauf verzichten, ihre Einkommen einfach zu verkonsumieren, und es stattdessen in gesellschaftlich nützlicher Weise im Wohnungswesen einsetzen. Ähnliches gelte für den Aktienmarkt: Wer sein Geld dort investiere, helfe Unternehmen dabei, durch Innovation die nächste Pandemie zu verhindern oder den Klimawandel zu besiegen. Hinter solchen Argumenten verbergen sich gleich mehrere ökonomische Fehlannahmen. Es lohnt sich, sie Stück für Stück auseinanderzunehmen.
Woher kommt das Kapital?
Wer sich heute an der Börse Aktien eines Unternehmens kauft – zum Beispiel die eines Solarzellenherstellers – stellt der Firma damit keineswegs neues Kapital zur Verfügung, das sie in effizientere Produktionsstraßen oder in ihr Forschungslabor investieren könnte. Beim Aktienkauf handelt es sich typischerweise um einen Transfer zwischen der Vorbesitzerin der Aktie – einer Privatperson, einer Bank, eines Investment- oder Pensionsfonds – und dem Käufer. Das betreffende Unternehmen erhält vom Kaufpreis der Aktie typischerweise gar nichts. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Aktie zum ersten Mal emittiert wird – dies kann aber schon Jahrzehnte zurückliegen – oder das Unternehmen selbst seine Aktien veräußert. Zwar ist es möglich, dass eine erhöhte Nachfrage den Aktienkurs steigen lässt, was das Unternehmen unter Umständen befähigt, mehr Kredite aufzunehmen, und so Spielräume für Investitionen schafft. Garantiert ist das jedoch nicht.
Wer Aktien kauft, sichert sich meist Anrechte auf jene Anteile der Profite von Unternehmen, die als Dividenden ausbezahlt werden – also darauf, den Unternehmen Geld zu entziehen. In der Regel tritt die Aussicht auf solche Zahlungen jedoch in den Hintergrund, denn die Hauptmotivation für viele Aktienkäufe ist die Hoffnung, diese später zu einem höheren Kurs verkaufen zu können. Manche Unternehmen zahlen nur sehr geringe Dividenden und erfreuen sich dabei stetig steigender Aktienkurse – einfach weil es genügend Käuferinnen und Käufer gibt, die darauf vertrauen, dass es weiter bergauf geht. Auch die Unternehmen haben Interesse an einem hohen Kurs, da sie bei einer künftigen Kapitalerhöhung weniger Anteile aufgeben müssen, um die gleiche Menge Kapital zu erlangen.
Ähnliches gilt im Fall von Immobilien: Wer in Berlin ein Mehrfamilienhaus aus dem 19. Jahrhundert oder einen DDR-Wohnturm erwirbt, trägt exakt nichts zur Schaffung neuen Wohnraums bei. Und neben den üppigen Großstadtmieten, die den Investorinnen sicher sind, spekulieren die meisten von ihnen auch auf weitere Wertsteigerungen.
Doch was ist mit Investoren, die einen Neubau in Auftrag geben? Hier wird zwar neuer Wohnraum geschaffen, jedoch orientiert sich dieser selten an den allgemeinen sozialen Bedürfnissen und zielt oft auf das Luxussegment ab. Doch selbst in Fällen, in denen dies nicht zutrifft, ist das Bild vom Investor als selbstlosem Kapitalspender lachhaft: Die allermeisten Menschen investieren nicht, weil sie weniger konsumieren als andere, sondern weil sie wegen ihres überdurchschnittlich hohen Einkommens trotz üppigem Konsum noch Investitionsmittel übrig haben. Es geht nicht nur darum, wer genau privates Investitionskapital besitzt: Die grundlegende Idee, dass Investitionen von Unternehmen – vor allem aber die der öffentlichen Hand – an die Sparwilligkeit von Privatpersonen gebunden sind, ist schlichtweg falsch.
»Die Vorstellung, dass 10.000 Euro auf Omas Notsparbuch die Triebfeder des globalen Kapitalismus sind, ist ein politisch motiviertes Märchen.«
Wie viel eine Gesellschaft insgesamt konsumieren, aber auch wie viel sie investieren kann, hängt von ihrer Fähigkeit ab, diese Güter überhaupt zu produzieren – also davon, wie viel sie wiederum in der Vergangenheit investiert hat. Daher spricht man auch von industrialisierten« Ländern, wenn es um reiche Gesellschaften mit höherem Lebensstandard geht, nicht von »Ländern mit hohem Kontostand«.
Vieles ist knapp – Geld aber nicht
Es gibt eine Reihe realer Beschränkungen, wie viel eine Gesellschaft investieren oder konsumieren kann: Güter wie Produktionsmittel, Infrastruktur, Bildung und Arbeitskraft lassen sich nicht einfach sprunghaft vermehren. Was es nicht gibt, ist eine fixe Geldmenge, die von privaten Investorinnen in die beiden Kategorien »Konsum« und »Investitionen« aufgeteilt wird. Die Entscheidung darüber ist immer und notwendigerweise politisch, auch im Kapitalismus. Industriegesellschaften steuern diesen Prozess über Instrumente wie Geldpolitik, Haushaltsdefizite, Steuern, Subventionen und Industriepolitik. Aktuell priorisieren wir damit die Disziplinierung der Arbeiterklasse durch Unterbeschäftigung sowie den Konsum der Oberklasse gegenüber der nachhaltigen Sicherung unseres langfristigen Wohlstands.
Egal, ob das Geld für eine neue Solaranlage nun von Blackrock, einem kanadischen Pensionsfonds, einem Bundessparbrief, der EZB oder Omas Sparbuch kommt: Irgendjemand muss Silizium, Kupfer und Aluminium fördern, die Chemikalien raffinieren, die Wafer schneiden, die Module verschrauben, das Gerüst aufbauen und die Wechselrichter anschließen. Geld erledigt nichts davon, denn Geld arbeitet nicht – es ermöglicht unter Umständen nur einigen wenigen Menschen, sich von der notwendigen Arbeit freizukaufen. Die Sinnhaftigkeit dieser Verhältnisse dürfen und sollten wir hinterfragen – dafür bedanken müssen wir uns aber auf keinen Fall.
Alexander Brentler ist Journalist und Übersetzer.