15. April 2022
Ingenieur der Seele
Andrej Platonow schrieb empathisch wie kein anderer über die Höhen der Revolution, die Tiefen des Stalinismus und den Traum einer ökosozialistischen Zukunft.
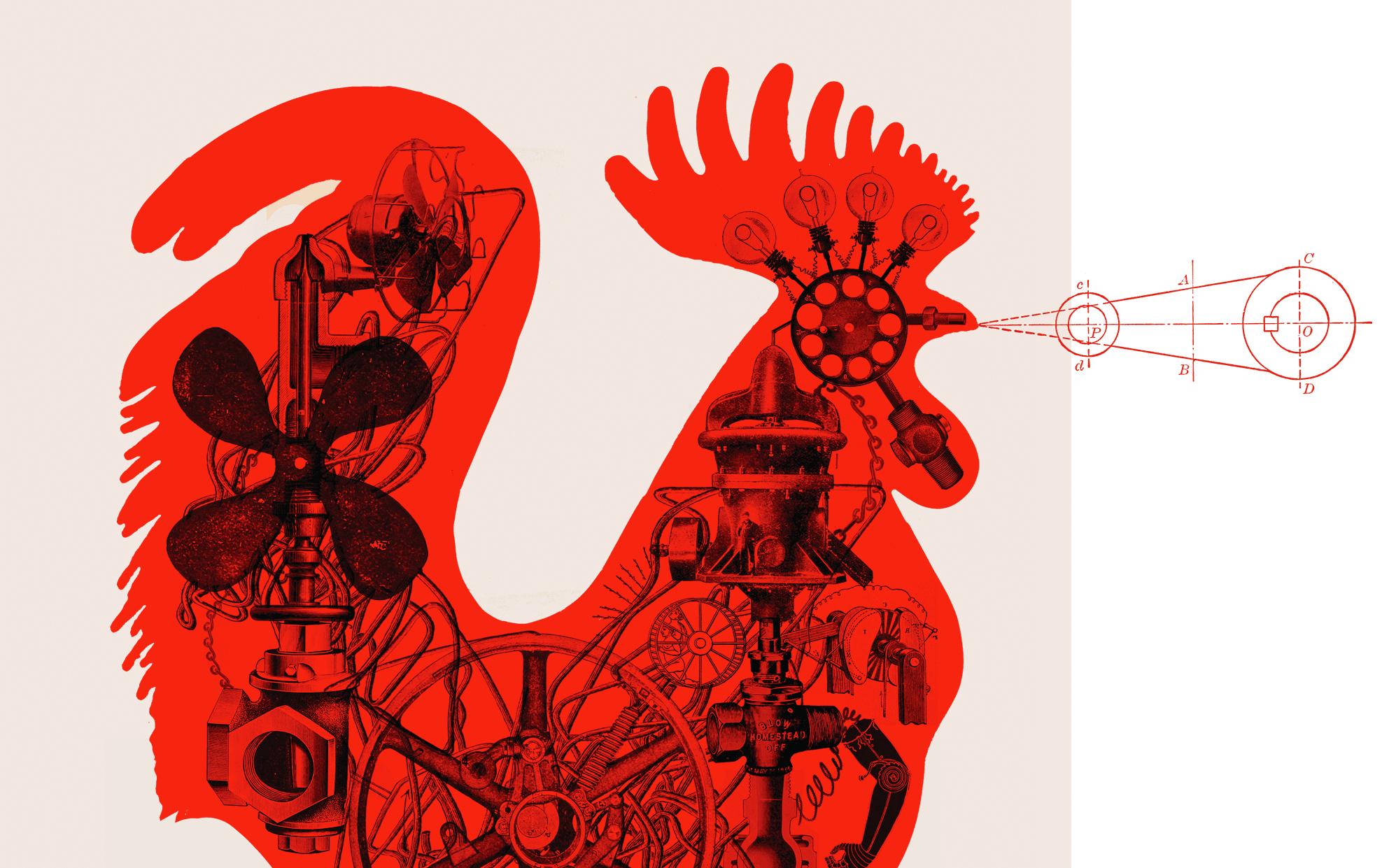
Der Nachthimmel wölbt sich kalt über der zentralasiatischen Wüste. Ein Moskauer Ökonom zählt die Schafe, die noch nicht dahingerafft wurden oder entlaufen sind. Um ihn herum schlafen mehrere Dutzend Menschen im Freien, Angehörige des Nomadenvolks Dshan. Seit Tagen ernähren sie sich nur von Vogelfleisch und trockenem Gras. Der Ökonom Tschagatajew weint, denkt an Moskau und fragt sich, wie er in dieser unendlichen, kargen Landschaft mit den ihm Anvertrauten den Sozialismus aufbauen soll.
Die Szene stammt aus dem Romanfragment Dshan oder Die erste sozialistische Tragödie des russischen Schriftstellers Andrej Platonow, der in den 1920er Jahren in einer ähnlichen Situation war: Als Bewässerungsingenieur reiste er im ersten Jahrzehnt nach der Russischen Revolution durch die Steppe, baute Brunnen, legte Sümpfe trocken, säuberte Flussbetten und beriet die bäuerliche Bevölkerung, um den Grundstein für ein Mindestmaß an sozialistischem Wohlstand zu legen.
Seit einigen Jahren wird Platonow wiederentdeckt, zahlreiche Neuübersetzungen bieten dem deutschsprachigen Publikum Zugang zu seinem faszinierendem Werk, das stets um die Sehnsucht nach einer verwirklichten Utopie inmitten historischer Widrigkeiten kreist. Dabei verarbeitete Platonow die Widersprüche und Abgründe der Sowjetunion, die er durch seine Arbeit mit der Landbevölkerung genau kannte.

Obwohl kaum einer von Platonows Romanen zu Lebzeiten erscheinen durfte und sein Sohn in ein Arbeitslager deportiert wurde, hat er dem sozialistischen Projekt nie die Treue gekündigt. Vielmehr verstand er seine Schriften als notwendigen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus – der Künstler war für ihn ein »Ingenieur der Seele«. Richtig versteht man Platonows Schaffen nur, wenn man begreift, welche Bedeutung der revolutionäre Aufbruch von 1917 für sein Leben hatte.
Eisenbahner mit offenem Herzen
Andrej Platonowitsch Platonow wurde 1899 als Sohn eines Lokomotivführers und einer Hausfrau geboren und wuchs im ländlichen Woronesch auf. Er arbeitete in seiner Jugend in einer Stahlgießerei und bei der Eisenbahn – die Spannung zwischen technologischem Fortschritt und ländlicher Rückständigkeit, die Platonow schon in der Kindheit erlebte, prägt den Großteil seiner Werke.
In seinem Roman Tschewengur: Die Wanderung mit offenem Herzen führt der Eisenbahnputzer Sascha ein Zwiegespräch mit einer Dampflok, die ihm verrät, dass ihre Kolbenstange in der Mitte abgenutzt ist und die Stopfbuchsen den Dampf durchlassen: »Ich mach das doch nicht mit Absicht«, sagt die Lok zu Sascha. Dieser stellt fest, dass die Lokomotiven, welche er wie Menschen liebt und die in ihm »Gefühle, Gedanken und Wünsche wecken«, »fügsame Wesen« seien. Sie würden die ganze Zeit für »fremde Menschen arbeiten« und nie diejenigen befördern, die sie erbaut hatten. Später wird sich Sascha den Bolschewiki anschließen.
Auch Platonow schlug sich in seiner Jugend auf die Seite der Revolutionäre. Nach der Revolution studierte er am Elektrotechnischen Institut des Wornescher Eisenbahn-Polytechnikums und nahm währenddessen an Gefechten gegen konterrevolutionäre Kosakenverbände teil. Gleichzeitig trat er als politischer Publizist und Lyriker in Erscheinung und kämpfte für eine neue proletarische Kultur, was im feudal-religiösen Russland auch hieß, die allgegenwärtige christliche Symbolik umzudeuten. So wird Jesus beim frühen Platonow zum sozialrevolutionären Propheten der Rache und des Zorns.
Die spontane Vermischung von christlichen und sozialistischen Vorstellungen im Denken der Menschen spielt auch in Tschewengur eine große Rolle. Platonow selbst sagte über dieses Werk, dass er darin den Anfang der kommunistischen Gesellschaft darstellen wollte – und dieser Anfang war geprägt von semantischem Chaos.
So zieht Sascha nach der Revolution zusammen mit dem ehemaligen Soldaten Kropotkin, der Rosa Luxemburg wie eine Heilige verehrt und stets ein Bild von ihr bei sich trägt, durch das Land, um die Stadt Tschewengur zu finden, in welcher der Kommunismus bereits angekommen sein soll.
Sozialismus in einem Dorf?
Was beim Lesen wie literarische Fiktion anmutet, war im revolutionären Russland tatsächlich Realität: Viele Landlose, ehemalige Soldaten und Wanderarbeiter gründeten Kommunen. Das Ende des religiös legitimierten Agrarfeudalismus wurde nicht selten als apokalyptisches Ereignis aufgefasst. Platonow schildert mit grenzenloser Einfühlsamkeit das Schicksal dieser Figuren, die in einer historischen Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gefangen waren, welche schon Marx Kopfzerbrechen bereitete.
Mehrere Male brach dieser 1881 die Antwort auf einen Brief der russischen Revolutionärin Wera Sassulitsch ab, die ihn mit Blick auf Russland fragte, ob es einen direkten Weg von der vorkapitalistischen Dorfgemeinde zum Sozialismus gebe, oder ob es notwendig des Zwischenschritts einer »ursprünglichen Akkumulation« bedürfe, in der die Landwirtschaft kapitalistischen Prinzipien unterworfen wird. Marx war in dieser Frage unentschieden und vertiefte sich nachweislich in die Geschichte der russischen Dorf- und Gemeindeverfassung, um Sassulitsch eine Antwort geben zu können: ja, vielleicht.
Diese theoretische Frage wird nach der Russischen Revolution praktische Relevanz erhalten; Platonows Tschenwengur ist die literarische Verhandlung dieses Problems. Der Roman schildert die Konfusion während des historischen Sprungs aus der Dorfgemeinschaft, die große Teile Russlands prägte, in den Sozialismus.
Dabei waren Platonows Werke jedoch das Gegenteil von dem, was die Partei ab 1932 unter dem Label »Sozialistischer Realismus« von der Kunstproduktion verlangte. Platonows Stil, den er in seiner Jugend erstmals in den Schreibzirkeln der kulturrevolutionären Bewegung des Proletkults erprobte, ist noch eine Frucht der historisch einmaligen Blüte avantgardistischer und proletarischer Kunst in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Das seelische Verlangen des Schriftstellers
Seinen Produktionsprozess als Schriftsteller beschreibt Platonow so, dass er in einem ledernen Heft alles notiert und einklebt, was ihm begegnet und was er in seiner Literatur verarbeiten will, »wie Zeitungsausschnitte, einzelne Sätze aus der Zeitung, Auszüge aus viel oder wenig gelesenen Büchern …, ich übertrage ungewöhnliche, lebendige Dialoge ins Heft, wie und wo immer sie mir begegnen. Ich notiere eigene Gedanken, Themen und Skizzen – versuche als Drahtigel durchs Leben zu rollen, damit an meiner ausgefahrenen Beobachtungsgabe alles hängen bleibt und aufgespießt wird.« Die auf diese Weise vollgeschriebenen Hefte bezeichnet Platonow als »Halbfabrikate«.
Das Textmaterial werde anschließend durch das »seelische Verlangen« des Schriftstellers strukturiert und zu einer Geschichte geformt, die nach Platonows Schätzung nur zu 5 bis 10 Prozent von ihm sei. Im Gegensatz zu den Vorgaben des Sozialistischen Realismus stehen in deren Zentrum allerdings keine vorbildlichen Heldenfiguren, sondern fast immer Außenseiter und Ausgestoßene, deren Bewusstsein und Sprache durch die offiziellen Formeln der Bolschewiki gebrochen werden wie ein Lichtstrahl durch ein Prisma.
In Platonows Baugrube lesen wir etwa die folgende, in ihrer stilistischen Schönheit kaum zu überbietende Passage: »Wotschew, mit dem Rücken gegen die Särge gestützt, schaute vom Wagen nach oben – in die Sternenversammlung und in die tote Massentrübe der Milchstraße. Er wartete, wann wohl dort eine Resolution verabschiedet wird zur Abschaffung der Ewigkeit der Zeit und zur Entgeltung der Qual des Lebens.«
In der Baugrube setzt sich Platonow mit dem Stalinismus auseinander. Das Werk zeichnet das Scheitern des kommunistischen Projekts nach: Es ist ein Trauerbuch. Platonow beschreibt das Stocken bei der Errichtung eines großen Wohnhauses, die Depression der Proletarier, die nicht mehr genau wissen, wofür sie leben und arbeiten und das Aufwachsen eines kleinen Mädchens namens Nastja.
Deren ganze Person ist erfüllt von Stalins Propaganda, sie ist der »neue Mensch«, jedoch nicht mehr als ein utopisches Wesen, sondern als Künderin einer Dystopie. Doch selbst in der Baugrube bleibt ein hoffnungsvoller Rest: am Ende wird die Grube zu einer Gruft werden und Nastja in sich aufnehmen. Der neue stalinistische Mensch ist geboren, aber er wird auch wieder verschwinden. Platonow stellt sich in seiner Kunst gegen den Terror.
Die Warnung der Wüste
Vom revolutionären Aufbruch in Tschewengur über die Zwangskollektivierung und das Stocken der Produktion in den 1920er Jahren in der Baugrube führt Platonows Schaffen mit dem Romanfragment Die glückliche Moskwa in das Herz des urbanen Stalinismus. Zusammen bilden die Werke eine Chronologie der frühen Sowjetunion. Platonows intellektuelle Weitsicht zeigt sich jedoch am deutlichsten in dem Roman Dshan, der erst 1964 posthum veröffentlicht wurde. Das Werk lässt sich unter Rückgriff auf Briefe und Essays Platonows als Kommentar auf die ökologische Katastrophe lesen, die sich infolge der unkontrollierten Entgrenzung der Technik einstellt.
In den jugendlichen Schriften Platonows finden sich noch technologisch-utopische Essays darüber, dass man mithilfe von »Wolkenimpfungen« das Wetter beeinflussen oder eine Bresche in den Ural zu sprengen könnte, um Sibirien zu erwärmen. In seinem späteren Werk wird der Schriftsteller-Ingenieur jedoch zunehmend sensibel für die Schattenseiten der technologischen Beherrschung der Natur.
In einem Zeitungsartikel von 1924 mit dem Titel »Der Mensch und die Wüste« schreibt Platonow: »Wir müssen vorwärts denken und unsere Arbeit nicht auf Tage, sondern auf Jahre und Jahrhunderte planen. Wir dürfen nach uns keine Wüsten hinterlassen und unsere Nachfahren nicht zu Flucht, Tod und Krieg verdammen.« Er mahnt, dass an den Orten, wo heute große Wüsten sind, früher arbeitsame Völker mit hochentwickelter Wissenschaft lebten, deren Wirtschaft aber aus dem Gleichgewicht geriet.
Die Reise des Ökonomen Tschagatajew, die der Entwicklungshilfe für die Dshan dient, spielt zwar in der Zeit des Stalinismus, kann aber auch als Warnung vor einer dystopischen Zukunft gelesen werden. Verhindert werden kann diese Platonow zufolge nur, wenn »wir die Natur bewahren und von den Folgen unseres Wirtschaftens heilen«.
Maxim Gorki warf Platonow einmal übersteigertes Interesse an Sonderlingen und Verrückten vor. Doch es ist genau dieser empathische Blick auf jene, die nicht in die offiziellen Erzählungen der Partei passten, der den hohen Wahrheitsgehalt von Platonows Schriften ausmacht. Die Landlosen von Tschewengur, die melancholischen Arbeiter der Baugrube und die Dshan – sie alle verkörpern die Herausforderung der Revolution und ihr Scheitern daran, eine gerechte Ordnung zu begründen.
Platonow hat diese Widersprüche in seiner Literatur thematisiert, weil er sein Schaffen bis zuletzt als Korrektiv zum offiziellen Parteidiskurs verstand. Sein Werk stellt sich gegen die Eindimensionalität des totalitären Denkens und entfaltet eine subtile Kritik an deren Gewalt. Es ist aber nicht bloß die Kritik eines Intellektuellen, sondern die eines Ingenieurs – von jemandem, der mit den Bäuerinnen und Arbeitern lebte und ihre Leiden kannte.
»Ohne mich ist das Volk nicht vollständig«, schrieb Platonow einmal. Er verstand sich nicht als einen, der über das Proletariat schreibt, sondern als Teil desselben. Seine Erfahrungen mit der Arbeit auf dem Land und seine genauen technischen Kenntnisse machen seine Literatur so faszinierend. Er hat diesen Erfahrungen eine ästhetische Form abgerungen, die sich in ihrer Einzigartigkeit etwa mit dem Stil Kafkas messen kann. Seine Romane bieten uns eine ästhetische Welt, die auch unsere Realität manchmal platonowesk erscheinen lässt. Die Lektüre Platonows schärft die Sinne für das Mehrdeutige und Entrückte, das unsere Theorien der Gesellschaft oft nicht abzubilden wissen. Sein Werk zeigt, dass sich hoher ästhetischer Anspruch und große Nähe zu den Menschen nicht ausschließen: »In der Epoche des Aufbaus des Sozialismus darf man kein reiner Schriftsteller sein«, schrieb Platonow. Man müsse als Schriftsteller-Ingenieur an der Konstruktion dieser neuen Welt teilnehmen.
Matthias Ubl ist Contributing Editor bei Jacobin und Chef vom Dienst beim Wirtschaftsmagazin Surplus.