13. September 2021
Liefern schlucken liefern schlucken
Die Monopolisierung des Buchmarkts setzt die literarische Vielfalt aufs Spiel.
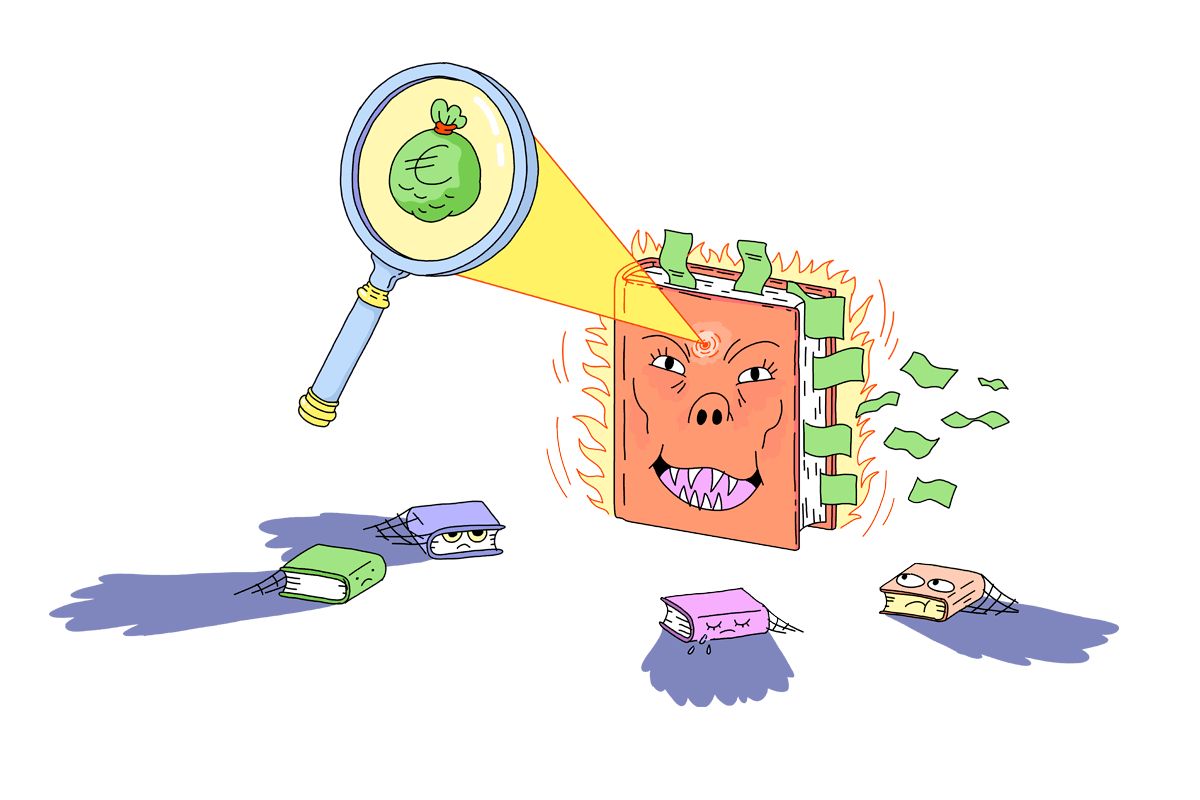
In unseren Bücherregalen verbirgt sich hinter den verschiedenen Verlagssignets auf den Buchrücken nicht selten ein einziger Konzern.
»Jetzt also hören wir es wieder läuten, das Sterbeglöcklein für die Literatur.« Im Jahr 1968 veröffentlichte der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in der von ihm gegründeten Zeitschrift Kursbuch einige »Gemeinplätze, die Neueste Literatur betreffend«. Der desaströse Zustand der Literatur, der Enzensberger zu dem Nachruf veranlasste, rührte aus seiner Sicht vom »Imperativ des Marktes« her: »Liefern schlucken liefern schlucken.«
Die Literatur, der im Zuge der 68er-Proteste ein emanzipatorischer Gehalt zugeschrieben wurde, war zugleich Teil einer »Bewusstseins-Industrie« geworden, die Bücher als massentaugliche Unterhaltungsware produzierte. Die dünnen rororo-Bändchen eroberten seit 1950 die entlegensten Leserschichten und die schmucken Ausgaben des Bertelsmann Leserings zogen in die kleinbürgerlichen Wohnstuben ein. In dieser Zeit wurde der Grundstein für einen konzentrierten Buchmarkt gelegt, der durch neue Unterhaltungstechnologien, elektronische Massenproduktion, wirtschaftlichen Aufschwung und gestiegene Konsumbedürfnisse geprägt war.
Denkt man an Literaturverlage, hat man für gewöhnlich Figuren wie Samuel Fischer, Carl Hanser, Ernst Rowohlt oder Peter Suhrkamp vor Augen. Vor allem Männer also, die ihre Verlage als Eigentümer mit starker paternalistischer Hand führten. Das ökonomische Geschick diente hier der Durchsetzung eines kulturellen Anliegens, wie Fischer beschreibt: »Der Verleger, als ein Mann, den es lockt, Arbeit und Geld an immaterielle Werte zu setzen, will Entdecker sein. Er will helfen, neue Werte ans Licht zu fördern, als organisierender Geschäftsmann neue Werte zu schaffen.«
Doch seit den 1960er Jahren dominieren globale Mischkonzerne wie Bertelsmann oder Holtzbrinck den Markt, in denen die Literatur nur ein Produktsegment unter vielen ist. Ihr Ziel ist nicht in erster Linie das Bilden von kulturellen, sondern das Akkumulieren von ökonomischen Werten. In unseren Bücherregalen verbirgt sich hinter den verschiedenen Verlagssignets auf den Buchrücken nicht selten ein einziger Konzern.
Der Buchmarkt neigt zum Monopol
Die große Welle der Übernahmen und Vereinigungen von Verlagskapital hält bis heute an. Erst 2020 wurde Bertelsmann Alleineigentümer der weltweit größten Verlagsgruppe Penguin Random House. Die enorme Kapitalkonzentration auf dem Buchmarkt ist keineswegs Zufall. Das Geschäftsprinzip von Buchverlagen beruht nämlich auf einer heiklen Risikokalkulation: Die Auflagenhöhe eines Titels spiegelt nur eine imaginierte Erfolgserwartung wider, die sich auf dem Markt keineswegs erfüllen muss. In wie vielen Warenkörben ein Buch landen wird, ist vorab nicht vorherzusehen – und damit ist auch der Rückfluss des investierten Kapitals ungewiss.
Der Flopp eines erwarteten Bestsellers, der mit hohen Garantiehonoraren eingekauft wurde, fällt bei einem Konzern, dessen Verlage jedes Halbjahr hunderte Bücher auf den Markt bringen, weniger ins Gewicht als bei einem kleinen, inhabergeführten Verlag, der auf diesen einen Titel gesetzt hat. Denn diese unabhängigen Verlagshäuser operieren meist nach dem Prinzip der Mischkalkulation, bei dem anspruchsvolle und darum oft weniger gut verkäufliche Literatur über Bestseller querfinanziert wird. Während mittelständische Verlage mit ihrer knappen Kapitaldecke zu chronischen Liquiditätsengpässen neigen, können Großkonzerne und multimediale Mischkonzerne den Unsicherheiten des Marktes trotzen und sich eine entscheidende Vorrangstellung in den risikobehafteten Teilmärkten sichern. Aufgrund dieser Dynamik stieg der Umsatzanteil derjenigen Verlage, die über 10 Millionen D-Mark Umsatz erwirtschafteten, ab den 1970er Jahren stetig an.
In den 1990er Jahren stand dann mit der Privatisierung des ostdeutschen Verlagswesens die Lesekultur eines ganzen Landes zum Schlussverkauf. Die allermeisten sozialistischen Verlage wurden durch die Treuhandanstalt an westdeutsche Konzerne verkauft, die diese nach kurzer Zeit dicht machten, um unrentable Verlagsbestandteile abstoßen und zugleich gewinnträchtige Lizenzen behalten zu können. Neben der Markterweiterung durch die Wiedervereinigung bauten die führenden Verlagskonzerne – allen voran die bereits erwähnten international agierenden Mischkonzerne Bertelsmann und Holtzbrinck – ihre Marktmacht durch Zukäufe renommierter Verlage im In- und Ausland aus.
Die Umsätze dieser Verlage in den letzten zehn Jahren bestätigen den Trend zur Kapitalexpansion und -verflechtung. Jene Verlage, die jährlich mehr als 50 Millionen Euro erlösen, erwirtschaften seit 2010 zwischen 68 und 78 Prozent des Gesamtumsatzes im Verlagswesen. Laut einer von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Studie, die dieses Jahr veröffentlicht wurde, ist zu erwarten, dass diese Umsatzkonzentration in den nächsten Jahren noch zunehmen wird.
Problematisch ist daran nicht nur, dass es in der Hand einiger weniger Konzerne liegt, welche Literatur wir letztlich als Buch kaufen können, sondern auch der damit einhergehende Wandel in der Art und Weise, wie Literatur produziert wird. An die Stelle der unternehmerischen Verlegerpersönlichkeit mit programmatischer Ausrichtung trat immer mehr das entpersonalisierte und funktional ausdifferenzierte Verlagsmanagement von Großkonzernen. »Viele Gründe kommen zusammen und machen es dem Lektor schwer, seine ursprünglichen Aufgaben zu lösen: wachsende Titelzahlen, steigende Kosten, Mangel an Zeit, zunehmende Spezialisierung, unsinnige Vorschüsse, wachsende Bürokratie usw.«, fasst Dieter Struss, ehemals Lektor bei Bertelsmann, bereits 1981 nüchtern zusammen.
Rendite über Literatur
Literaturverlage in Mischkonzernen funktionieren grundlegend anders als inhabergeführte Verlagshäuser. Das liegt nicht zuletzt an den veränderten Eigentumsstrukturen: Der Verlag ist hier Teil eines übergeordneten Unternehmens, das seinen Profit nicht nur mit Büchern, sondern mit einem diversifizierten Produktportfolio erwirtschaftet. An dessen Spitze steht nicht mehr die Inhaberin, sondern es sind angestellte Manager, die über erfolgsorientierte Klauseln in den Anstellungsverträgen die Rendite der Aktionärinnen maximieren sollen.
Nicht ohne Grund betitelt der US-amerikanische Verleger André Schiffrin seine autobiografische Skizze zum Strukturwandel des Verlagswesens aus dem Jahr 2000 Verlage ohne Verleger. Mit dem Eigentümerwechsel stiegen nicht nur die Renditeerwartungen an den Verlag von 2 bis 5 auf 15 Prozent, gleichzeitig »wurde von jedem Titel erwartet, daß er einen ausreichend großen Beitrag sowohl zur Deckung der Gemeinkosten als auch zum Gewinnerlös beisteuerte«, so Schiffrin. Das Prinzip der Mischkalkulation wird damit zugunsten klar umrissener Rentabilitätskriterien aufgekündigt.
»Statt der paternalistischen Kontrolle eines Kulturverlegers unterstanden die Mitarbeiterinnen nun einer anonymen Ergebniskontrolle.«
Auch in Deutschland wurde mit der Jahrtausendwende ein Teil der Verlagshäuser, die Mischkonzernen unterstanden, stärker ökonomischen Effizienzkriterien untergeordnet. Unter ihnen die traditionsreichen Verlage des Holtzbrinck-Konzerns – wie S. Fischer, Rowohlt oder Droemer Knaur –, die von der Unternehmensberatung McKinsey restrukturiert wurden. Statt der paternalistischen Kontrolle eines Kulturverlegers unterstanden die Mitarbeiterinnen nun einer anonymen Ergebniskontrolle.
Allerdings erwies sich die strikte Renditeorientierung bei einer Ware, die auch ästhetischen Gesetzen gehorcht, für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg letztlich als ineffizient. Standardisierte Vorgaben und einheitliche Gewinnmargen wurden dem schnelllebigen Literaturmarkt nicht gerecht. Der Versuch, die konstitutive wirtschaftliche Ungewissheit von ästhetischen Waren über strikte Kontrollen zu minimieren, wurde für die Konzerne zu einem verlustreichen Geschäft. Der Handel mit Büchern verlangt jenes literarische Gespür, das durch das Management zurückgedrängt worden war.
Der neue Geist des kapitalistischen Buchmarkts
Interessanterweise installierte Bertelsmann, der Riese der Verlagswelt, darum schon früh ein dezentrales Management, das den Verlagen in ihrem Hauptgeschäft – der Autorenbetreuung – relative Eigenständigkeit zusprach. Dies schien zunächst eine für beide Seiten profitable Verbindung zu sein: Der Kernbereich des Verlags blieb nach der Übernahme intakt und die Verlagsleitung konnte mit ihrer kaufmännischen Erfahrung flexibel auf literarische Trends reagieren. Gleichzeitig wurde das unternehmerische Risiko durch den kapitalstarken Großkonzern abgefedert. Mit dem partiellen Rückzug multimedialer Konzerne (wie der Axel Springer AG im Jahr 2003) aus dem literarischen Buchmarkt spezialisieren sich auch andere Unternehmen wieder stärker auf das Kerngeschäft und strukturieren ihre Organisation entsprechend der Eigengesetzlichkeit von Buchwaren um. Die aufgekauften Verlage werden dabei als sogenannte Imprints mit ihrem tradierten Verlagsprofil weitergeführt, was einerseits eine Rückkehr der verlegerischen Eigenverantwortung bedeutet, andererseits aber einen Vorstoß der Konzerne in bestimmte Marktsegmente und Trends, die für ihre trägen Apparate andernfalls nicht zugänglich wären.
Auf diese Weise können sie marktferne literarische Nischen besser durchdringen, die bislang von sogenannten Independent-Verlagen dominiert werden – also jenen Verlagen, die unabhängig von einem Konzern wirtschaften und die oft als Beleg für die Vielfalt der deutschsprachigen Lesekultur herangezogen werden. Das Sterbeglöcklein der unabhängigen Literatur, das Enzensberger vor über fünfzig Jahren läuten hörte, müsste in der Folge heute lauter klingen denn je. Die Zahl der kleinen Verlage ist seit Jahren rückläufig – wie die oben erwähnte Studie ergab, ist sie allein zwischen 2010 und 2018 um 22 Prozent gesunken.
»Das Seltsame, Schwierige, Entrückte oder Experimentelle erscheint nur in kleiner Auflage, die in der Bilanz meist rote Zahlen schreibt.«
Die Corona-Pandemie hat das Ungleichgewicht auf dem Buchmarkt noch verstärkt: Zwar erwartet mit 76 Prozent die große Mehrheit der in der Studie befragten Verlage einen Umsatzrückgang für das Jahr 2021, jedoch leiden kleine und mittlere Verlage besonders stark unter der sinkenden Nachfrage. Ihre Kapitaldecke ist zu dünn, um den Verlust auffangen zu können – und das hat Einfluss auf die literarische Programmgestaltung: Statt auf gewagte Titel oder unbekannte Autorinnen setzt man auf das risikoarme Geschäft mit dem Bekannten.
Die ökonomische Durchdringung subkultureller Kleinverlage führt zunächst nicht zu gähnender Konformität in den Auslagen, sondern dazu, dass eine fast schon überfordernde Vielzahl verschiedenster Titel verlegt werden. Dies ändert sich jedoch, sobald konjunkturelle Marktschwankungen oder Krisen die Konzernverlage in Bedrängnis bringen, woraufhin diese unprofitable Verlage oder Verlagsteile abstoßen. Konzerne kaufen Verlage nicht im kulturpolitischen Auftrag – es ist ihre expansive Dynamik, die sie in neue und erfolgsversprechende Märkte vordringen lässt. Unter der Kontrolle von Konzernen wird die Verlagslandschaft nicht nachhaltig divers bleiben können. Denn das Seltsame, Schwierige, Entrückte oder Experimentelle erscheint nur in kleiner Auflage, die in der Bilanz meist rote Zahlen schreibt.
Literarische Pluralität lässt sich letztlich nicht über die Kontingenz des Marktes herstellen – eines Marktes, in dem eine Handvoll Verlage eine fast oligopole Stellung einnehmen. Für gewöhnlich wurde den sozialistischen Ländern genau dies vorgeworfen, verwirklicht hat es aber erst der spätkapitalistische Buchmarkt.
Dieser Artikel enthält Auszüge aus Carolin Amlingers Buch »Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit«, das im Herbst 2021 im Suhrkamp Verlag erscheint.
Carolin Amlinger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Seminar der Universität Basel.