03. Dezember 2020
Das Ende der schwarzen Null?
Die Corona-Krise hat das neoliberale Diktat der Schuldenbegrenzung untergraben. Jetzt ist die Zeit für staatliche Investitionen in einen starken Green New Deal, der Nachhaltigkeit und Gemeinwohl ins Zentrum stellt. Das Geld ist da.
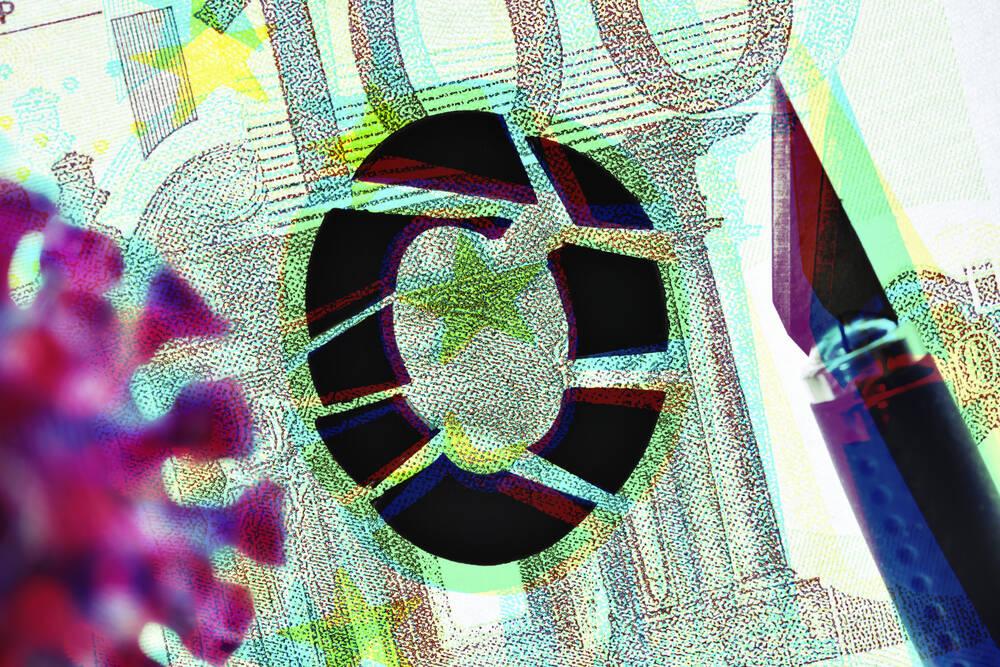
Krisenbedingt wurde das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts vorerst beiseitegeschoben.
Die durch die Covid-19 Pandemie bedingte Wirtschaftskrise hat eine Situation geschaffen, die alte Regeln ins Wanken bringt. Lang hochgehaltene Dogmen wie die schwarze Null und die »schwäbische Hausfrau« werden angefochten, während die Zentralbank mit Ankaufprogrammen in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro aufwarten. Die EU-Kommission lächelt gütig aus Brüssel herüber – die Defizitgrenzen sind für dieses und nächstes Jahr aufgehoben. Von der »fiskalischen Nachhaltigkeit« scheint man sich verabschiedet zu haben. Sogar die konservativen Tories haben die Industriepolitik wiederbelebt und fordern, dass der Staat den Unternehmen tatkräftiger unter die Arme greift. Die EU-Kommission hat mit ihrem »Green Deal« auf den Green New Deal reagiert, der von progressiver Seite seit mehr als zehn Jahren gefordert wird. Das liberale Wirtschaftsmagazin The Economist schlägt vor, die Höhe der erlaubten staatliche Defizite an der aktuellen Arbeitslosigkeitsrate festzumachen. Der Paradigmenwechsel so scheint es, kommt vielleicht doch schneller, als sich das viele vorstellen können. Notwendig ist dieser allemal, denn der Klimawandel lässt sich nur noch in diesem Jahrzehnt effektiv bekämpfen. Wir können es uns nicht länger leisten, nichts zu tun.
Wenn also die vermeintlich unumstößlichen Wahrheiten von gestern keine mehr sind, auf welcher theoretischen Grundlage wird dann die Politik von morgen gemacht? Die Begrenzung der Staatsausgaben wird dieser Tage theoretisch wie auch politisch revidiert. Die aktuelle Rezession hat wieder einmal sehr deutlich gezeigt, dass sich in der Krise die Unternehmen an den Staat wenden. Dieser wiederum wendet sich aber nicht an »die Steuerzahler«, sondern an Brüssel und Frankfurt. Augenscheinlich ist es also ein Mythos, dass sich die Staatsausgaben über Steuern finanzieren. Unser Geld kommt von der Europäischen Zentralbank, die ein Monopol auf die Ausgabe von Euros hat. Nur sie darf Bargeld und Zentralbankguthaben in Euro in Umlauf bringen. Da Staaten immer über ihre nationalen Zentralbanken Geld ausgeben, kann das von Banken erzeugte Giralgeld – ein Zahlungsversprechen in Euro – die Ausgaben der Bundesregierung nicht finanzieren.
Ein rascher Gesinnungswechsel
Ein Blick zurück: Am 13. März 2019 befragte die Initiative on Global Markets (IGM) der Universität Chicago Expertinnen und Experten von renommierten Universitäten wie dem MIT, Havard, Yale oder Berkeley zu folgender Aussage: »Länder, die Kredite in ihrer eigenen Währung aufnehmen, sollten sich keine Sorgen über Staatsdefizite machen, da sie immer Geld zur Finanzierung ihrer Schulden schaffen können«. Die Reaktion der Runde war eindeutig: Alle hielten dieses Statement, das der Modern Monetary Theory (MMT) zugeordnet wurde, für strittig. Diese Einhelligkeit überrascht, da die MMT außerhalb der akademischen Ökonomik durchaus namhafte Fürsprecherinnen und Fürsprecher hat. So können etwa die EZB-Präsidenten Mario Draghi und Christine Lagarde der MMT etwas abgewinnen, ebenso wie der Herausgeberkreis des Wall Street Journal oder auch Teile der Finanzindustrie. In der Politik war die MMT ebenfalls prominent vertreten. So ermutigte nicht zuletzt Alexandria Ocasio-Cortez Journalistinnen und Journalisten dazu, sich mit moderner Geldtheorie zu beschäftigen. MMT-Ökonomin Stephanie Kelton, deren Buch The Deficit Myth in den USA sofort zum Bestseller wurde, beriet Bernie Sanders in ökonomischen Fragen.
Ein Jahr später erzeugt die Covid-19 Pandemie einen heftigen Abschwung in der Weltwirtschaft, auch die Steuerzahlungen an den Staat kollabieren. Das Staatsdefizit der US-Regierung für das fiskalische Jahr 2020 betrug rund 3.000 Milliarden Dollar und war damit etwa dreimal so hoch wie noch 2018. Doch niemand stellt die Frage, ob die US-Regierung ihre Rechnungen bezahlen kann – denn das kann sie. Entscheidend ist vielmehr, wie viel wofür ausgegeben wird. Schließlich sind die Ressourcen – Arbeitskräfte, Energie, Rohstoffe, Maschinen, Gebäude – begrenzt. Die Wirtschaft wird durch die verfügbaren Ressourcen, nicht durch das verfügbare Geld, bedingt.
Diese Einsicht ist vor allem der Modern Monetary Theory zu verdanken, einer empirisch belegbaren Geldtheorie, die Mitte der 1990er Jahre entworfen und seitdem weiterentwickelt wurde. Sie beschäftigt sich mit der Beschreibung der Geld- und Kreditschöpfung bei Staat und Banken. Aus den so gewonnenen Erkenntnissen können wirtschaftspolitische Schlüsse gezogen werden, die im Gegensatz zu denen der Initiative on Global Markets auch den Entwicklungen der Realität standhalten.
Ein wesentliches Ergebnis der MMT ist die Unterteilung in Emittenten und Nutzer einer Währung. Der Staat ist Schöpfer der Währung und die Zentralbank verwaltet das Zahlungssystem, quasi eine riesige Excel-Tabelle mit Kontoständen der Banken. Ähnlich wie wir Konten bei unseren Banken haben, führen die Banken ihre Konten bei der Zentralbank. So führt etwa die Federal Reserve Bank als fiskalischer Agent des Staates auch die Zahlungen der US-Regierung in Washington aus. Die Bundesregierung der USA erzeugt durch ihre Ausgaben neues Zentralbankgeld, welches sie später über Steuern wieder vernichtet. Dabei erhöht die Zentralbank einfach den Kontostand des Empfängers, wenn die Bundesregierung Geld ausgibt. Zahlt eine US-Amerikanerin Steuern, dann reduziert die Zentralbank das Konto der dazugehörigen Bank um den entsprechenden Betrag. Man kann sich das Ganze vorstellen wie im Kino. Hier werden Tickets verkauft und dann am Einlass wieder zurückgenommen. Die eingesammelten Tickets haben keinen »Wert« und landen im Papiermüll. Digitale Tickets, die per Handy vorgezeigt werden, verfallen einfach. Das Kino bekommt sie nicht zurück. So ist es auch bei den modernen Zentralbanken, wenn sie digitales Geld erzeugen.
Die wirtschaftspolitische Reaktion in der Eurozone
Diese neue Sichtweise auf das Geld wird von der Realität bestätigt. Alan Greenspan, Notenbankpräsident der USA, sagte einmal unter Eid vor dem Kongress: »Es gibt nichts, was die US-Regierung daran hindert, als Zahlung an jemanden so viel Geld zu schaffen, wie sie will.« Auch Mario Draghi, ehemaliger Präsident der EZB, bestätigte einst bei einer Pressekonferenz, dass der EZB das Geld nicht ausgehen könne. Seine Nachfolgerin Christine Lagarde bekräftigte das erst kürzlich.
Nur hat sich diese Erkenntnis seltsamerweise noch nicht bis an die Universitäten und zu den dort lehrenden VWL-Professorinnen und -Professoren herumgesprochen. In den Lehrbüchern wird nach wie vor vom »fiskalischen Spielraum« geschrieben und zur Einhaltung der Schuldengrenzen gemahnt. Während derartiges Moralisieren mit der »Schuld« und »Verschuldung« der Standard in den Wirtschaftswissenschaften ist, zeigt uns das Jahr 2020, dass dem Staat das eigene Geld tatsächlich nicht ausgeht.
In der Eurozone ist inzwischen sonnenklar, dass sich die Eurokrise von 2010 nicht wiederholen wird. Damals hatten die Investoren Zweifel an der Zahlungsfähigkeit der griechischen Regierung. Da deren Steuereinnahmen in der Krise massiv einbrachen, hing die Zahlungsfähigkeit lediglich davon ab, ob die Europäische Zentralbank als Ankäuferin der letzten Instanz zur Verfügung stehen würde. Hätte sie dies getan, wären die Anleihen risikolos – die Investoren könnten sie immer an die EZB verkaufen. Unter Jean-Claude Trichet entschied sich die EZB allerdings anders. Die Investoren wollten keine neuen griechischen Staatsanleihen mehr kaufen, wodurch die Zahlungsfähigkeit der Regierung Schaden nahm. Es folgten Austeritätspolitik, Schuldenschnitte, Bankenkollaps, Lohnkürzungen, Privatisierungen und noch mehr neoliberale Politik. Das Ergebnis: 2019 war das Bruttoinlandsprodukt von Griechenland etwa 20 Prozent niedriger als vor der globalen Finanzkrise von 2008/9. Die Arbeitslosenquote betrug 17 Prozent, unter jungen Menschen sogar 35,2 Prozent.
Diese Strategie wird aktuell nicht wiederholt, weil erstens die Defizitgrenzen ausgesetzt sind und zweitens die EZB die Zahlungsfähigkeit aller nationalen Regierungen in der Eurozone garantiert. Die EZB kann das, indem sie über das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) massenhaft Staatsanleihen ankauft und somit den Investoren signalisiert: Wenn die Preise fallen sollten, stünde die EZB immer als Käuferin bereit. Dadurch sind die Anleihen letztlich so gut wie Bargeld – ohne Risiko eines Wertverlustes. Zudem hat der Rat der EU auf Vorschlag der Europäischen Kommission die allgemeine Ausstiegsklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts aktiviert. Die Defizitgrenzen sind damit zumindest für 2020 und 2021 kein Thema. Nun können die nationalen Regierungen so viel Geld ausgeben, wie sie wollen – zumindest auf dem Papier.
Hinter den Kulissen aber tobt nun ein Kampf um die Zukunft der Eurozone. Eine Gruppe um den französischen Präsidenten Macron fordert »mehr Europa« und auch ein europäisches Finanzministerium. So könnte die EU-Kommission durch ihre Ausgaben die Wirtschaft steuern: in schlechten Zeiten gibt sie mehr Geld aus, in guten Zeiten weniger. Die EZB zahlt die Rechnungen der EU-Kommission und bekommt dafür Eurobonds, welche dann – ebenso wie die nationalen Anleihen – als risikolose Anleihen fungieren. Um diesen Weg zu gehen, müsste das PEPP permanent verankert werden. Damit wären die Finanzmärkte nicht mehr die Hüter der nationalen Finanzen – eine Rolle der sie ohnehin nicht gerecht wurden und die sie überforderte. So sanken beispielsweise die Preise griechischer Anleihen erst Anfang 2010, als es schon zu spät war. Die Finanzmärkte sind getrieben von Spekulationen und Blasen, die sehr profitabel sein können – so profitabel, dass in guten Zeiten alle mitschwimmen wollen, auch wenn garantiert irgendwann der Wasserfall kommt. Betrug gehört dabei nicht selten zum Geschäftsmodell. Und wenn dann die Krise kommt, springt die Zentralbank ein und es gibt einen Bail-out. Die Alternative wäre die Vernichtung von Geldvermögen in Höhe von Hunderten von Milliarden von Euro und eine wohl jahrelange Depression.
Die Bewahrer des Status Quo möchten, dass die Eurozone keine Reformschritte unternimmt. Dabei wird betont, dass Staatsschulden »fiskalische Risiken« darstellen und »fiskalische Transfers« aus politischen Gründen nicht in Frage kommen würden. Dieser Sichtweise zufolge sind Staatsschulden schlecht, denn sie führen dazu, dass irgendwann andere Länder für diese Staatsverschuldungen zahlen müssen. Dabei wird übergangen, dass die EZB das Ausfallrisiko der Staatsanleihen der Eurozonenländer, unabhängig von den Ratingagenturen, auf null setzten könnte – wenn sie denn wollte. Das Ausfallrisiko ist also immer schon eine politische Variable, keine »fiskalische«. Das gleiche gilt übrigens für die Zinsen der EZB, die ebenfalls eine Steuervariable sind und kein »Marktergebnis«.
Paradigmenwandel
Auch in Deutschland tut sich etwas im Diskurs um die sogenannte Staatsverschuldung. In einem kürzlich erschienen Beitrag im Wirtschaftsdienst untersuchen Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft, und Jens Südekum, Professor an der Universität Düsseldorf und Mitglied des Wirtschaftsrats der SPD, »Die Schuldenbremse nach der Corona-Krise«. Beide Autoren kritisieren die geringen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, die auf das neoliberale Paradigma – repräsentiert durch einen »schlanken Staat«, Privatisierung und Deregulierung – zurückzuführen sei. Als weitere Ursachen werden die fiskalische Regeln, allen voran die Schuldenbremse, sowie der Steuerföderalismus genannt.
Hüther und Südekum schlagen vor, dass der Staat Investitionen in größerem Ausmaß tätigen solle. Nur so wäre »eine dynamische Entwicklung der Steuereinnahmen zu schaffen«. Dabei würde der Staat »nachhaltig mit Krediten finanziert werden« – zumindest solange der durchschnittliche Zinssatz unter der Wachstumsrate des BIPs des Vorjahrs liegt. Dies würde einen »strukturellen Wandel« der Fiskalpolitik bedeuten. Dazu soll die Konsolidierung der staatlichen Haushalte in Europa verzögert erfolgen und die EU ein durch Anleihen finanziertes zusätzliches Investitionsbudget aufstellen. Eine gesteigerte Produktivität soll die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöhen und ihre Kosten senken sowie dringend benötigte Steuergelder in die leeren öffentlichen Kassen spülen, um den »Schuldencrash« aufzuhalten.
Vollbeschäftigung, Preisstabilität und nachhaltiges Wirtschaften
Dieser Paradigmenwechsel weist in die richtige Richtung, schöpft aber bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten aus. Denn die Staatsausgaben könnten am Gemeinwohl anstatt an finanziellen Kennzahlen ausgerichtet werden, wie es auch der Leitgedanke einer demokratisch legitimierten Regierung vorsieht. Es ist wissenschaftlich nicht belegt, dass willkürliche Referenzwerte, wie etwa die anvisierte Obergrenze einer Staatsverschuldung von 60 Prozent des BIPs, irgendeinen positiven Effekt auf eine Gesellschaft haben. Auch die Zahlen der Defizite bei den Maastricht-Regeln und der Schuldenbremse sind willkürlich. Die Alternative zu einer technokratischen Steuerung besteht in der Ausrichtung an Kennzahlen wie etwa der Arbeitslosenquote. Wenn wir Bürgerinnen und Bürger haben, die arbeiten wollen, aber keinen Arbeitsplatz finden, warum soll der Staat dann nicht einfach seine Ausgaben erhöhen und diese Menschen beschäftigen? Unsere Gesellschaft hat schließlich viele Defizite und es gibt einiges zu tun.
Die Idee, dass die Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat Rechte und Pflichten haben, ist zentral. Der Staat hat diese Rechte wiederum durchzusetzen. Das Recht auf Bildung erfordert etwa, dass in Deutschland Schulen und andere Bildungseinrichtungen vom Staat bezahlt werden und größtenteils kostenfrei zugänglich sind. Neben fundamentalen Rechten wie dem Recht auf körperliche Unversehrtheit garantiert der Staat aber auch das Recht auf Gesundheitsversorgung, Rente, eine heile Umwelt und vieles weitere. Auch ökonomische Rechte zählen dazu, wie das Recht auf einen Arbeitsplatz, das in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist.
Letzterem würde ein Vollbeschäftigungsprogramm gerecht werden: Jobgarantie, Green New Deal für Europa, verkürzte Arbeitswoche, bessere Löhne und mehr Macht für Gewerkschaften. Ein besseres Gesundheitssystem, das einer Notsituation wie der Corona-Pandemie gewachsen wäre, ließe sich durch eine Erhöhung der Staatsausgaben und Ressourcen realisieren: Krankenhäuser könnten mehr Betten einrichten und mehr Personal zu besseren Löhnen einstellen. Auch eine sichere Rente ließe sich verwirklichen, wenn der Staat die staatlichen Renten erhöhen und ineffiziente Programme wie die Riester-Rente zurücknehmen würde. Und die EZB könnte für die Zahlungsfähigkeit der Eurozonenländer garantieren, so dass niemand mehr Angst vor einem Crash haben müsste.
Das zeigt, dass erst die Abkehr von der Vorstellung des Staats als »schwäbischer Hausfrau« dazu führen kann, dass wir in der Politik die wesentlichen Defizite unserer Gesellschaft angehen. Das Gemeinwohl ist dabei definiert durch das, was politisch in einer Demokratie mehrheitsfähig ist. Die Regierung beschließt dann die entsprechenden Ausgaben, um Ressourcen zur Durchsetzung dieser Rechte zu mobilisieren. Die Bevölkerung wiederum stimmt dann bei den Wahlen auch darüber ab, ob sie mit dem Ergebnis zufrieden ist oder nicht.
Sowohl in Deutschland als auch anderswo in Europa besteht in vielerlei Hinsicht Handlungsbedarf: bei der Klimapolitik, im Umweltschutz, bei der Ungleichheit der Vermögen und Einkommen, im Gesundheitssystem, bei der Kinderarmut, bei der Jugendarbeitslosigkeit, bei den Renten – die Liste ist schier endlos. Erst wenn wir beginnen, die verfügbaren Ressourcen so einzusetzen, dass sie das Gemeinwohl und nicht die Profite der Unternehmen und ihrer Lobbyisten steigern, erleben wir eine Neuausrichtung unserer Wirtschaftspolitik. Dass diese gesellschaftlich mehrheitsfähig ist, zeigte sich schon nach der Finanzkrise. 2012 ermittelte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts emnid, dass zwei von drei Befragten dem Kapitalismus nicht zutrauen, Ziele wie den »sozialen Ausgleich in der Gesellschaft«, den »Schutz der Umwelt« oder einen »sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen« zu gewährleisten.
Koalition für progressive Politik
Welche neuen Möglichkeiten für eine progressive Politik eröffnen sich durch den gegenwärtigen Paradigmenwechsel? Die Vorschläge von Hüther und Südekum weisen eine politische Schnittmenge auf, die groß genug sein dürfte, um ein progressives Projekt loszutreten. Im Mittelpunkt steht dabei der sozial-ökologische Umbau durch einen Green New Deal. Inzwischen ist Konsens, dass das jetzige Wirtschaften mit Ressourcen und Energie nicht nachhaltig ist. Dass wir einen Umbau der Gesellschaft brauchen, steht außer Frage.
Ein Green New Deal, der ein öffentliches Investitionsprogramm, eine Jobgarantie und eine Verkürzung der Arbeitszeit mit einer Strategie verbindet, die soziale Härten finanziell abfedert, wäre ein lohnendes Projekt, um das sich eine Koalition für progressive Politik formieren könnte. Sowohl SPD, Grüne und Linke könnten sich mit ihren jeweiligen Anliegen darin wiederfinden. Den Wählerinnen und Wählern ist die Wirtschaft ein zentrales Anliegen, das hat zuletzt auch die US-Wahl wieder gezeigt. Überwältigende 83 Prozent der Trump-Wählerschaft sahen diesen Punkt als sehr wichtig an. Laut Europäischer Kommission sind etwa ein Viertel der Deutschen der Meinung, dass der Klimawandel und die wirtschaftliche Lage die beiden wichtigsten Probleme unserer Zeit darstellen. In Deutschland wird besonders der Umwelt- und Klimaschutz zunehmend größere Bedeutung beigemessen. Nach einer Studie des Bundesumweltamtes waren 2016 etwa die Hälfte der Befragten der Meinung, dass Umwelt- und Klimaschutz eine sehr wichtige Herausforderung darstellen und im letzten Jahr waren es sogar jeweils bei 64 und 68 Prozent.
Eine Koalition für progressive Politik müsste die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, dass die Ängste vor Staatsverschuldung und Defiziten dem Land und ihnen geschadet haben und dass es sich lohnt, Wirtschaftspolitik neu zu denken. In der Bevölkerung scheint diese Einsicht schon durchgesickert zu sein. So gaben vor der Corona-Krise in einer Umfrage der Europäischen Kommission gerade einmal 3–5 Prozent der Deutschen an, dass sie die Staatsverschuldung als Problem erachten, und selbst im Sommer dieses Jahres waren es lediglich 10 Prozent. Ebenso viele hielten die Arbeitslosigkeit für das größte Problem. Hier sollte der Staat die Chance ergreifen, um aufzuklären und Beschäftigungsgewinne zu schaffen. Wenn das Gemeinwohl das Ziel wäre, dann könnte der Staat mit seinen Ausgaben auch jenseits der produktivitätssteigernden Investitionen die Lebensqualität in Deutschland verbessern, indem beispielsweise die Menschen in der Pflege und in der Gesundheit besser bezahlt würden und die »Care Economy« auch finanziell vergütet würde.
Eine politische Mehrheit für ein solches Projekt gibt es sicherlich schon. Die Zeichen der Zeit sind deutlich. Fridays For Future mobilisiert auf der Straße, die EU hat mit dem Green Deal immerhin das Problemfeld besetzt und es ist gesellschaftlicher Konsens, dass die sozial-ökologische Transformation jetzt beginnen muss. Das Geld ist ebenfalls da, denn die Defizitregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind bis 2022 ausgesetzt und die EZB stellt die Versorgung der nationalen Regierungen mit Euros sicher. Im Artikel 3 des Vertrags über die EU werden Vollbeschäftigung und sozialer Fortschritt ausdrücklich als Zielvorgaben genannt. Die deutsche und die europäische Politik sollte die Chance, die diese Krise bietet, nutzen, um die Politikfehler aus der Zeit der Finanzkrise auszubügeln und sich um die Probleme der Europäerinnen und Europäer kümmern.
Dirk Ehnts ist Sprecher und Mitbegründer der Pufendorf-Gesellschaft für politische Ökonomie e.V. und Autor des Buchs »Geld und Kredit: Eine €-päische Perspektive«.