13. Dezember 2021
Prophet der Callout Culture
Am 22. November 2013 veröffentlichte die britische Website The North Star einen Essay des Kulturtheoretikers Mark Fisher unter dem Titel »Exiting the Vampire Castle«.
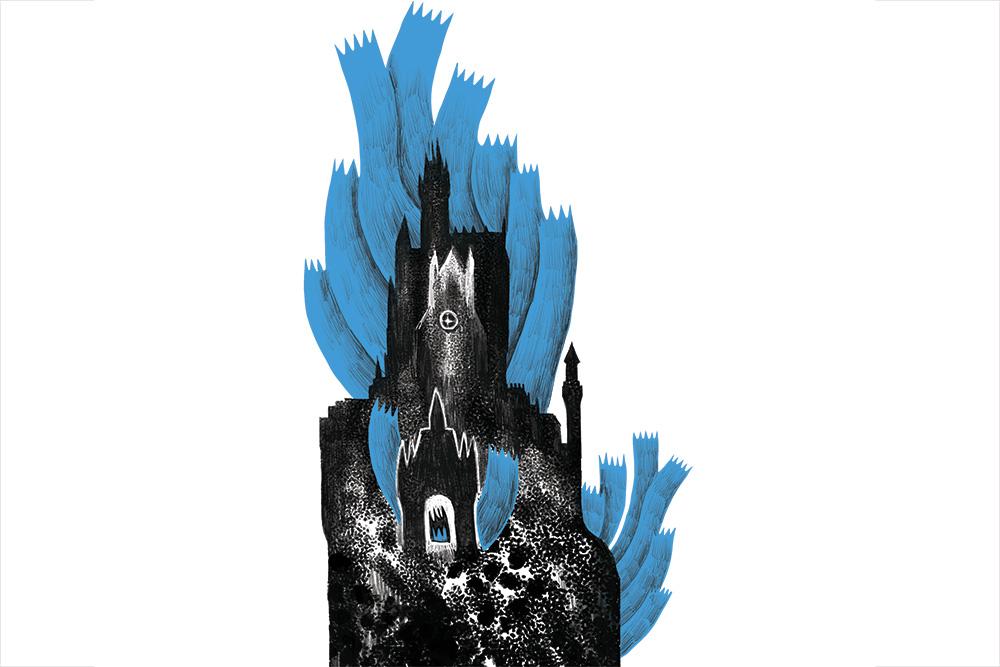
Das Motiv des Vampirschlosses birgt eine Vielzahl von Verweisen: auf die parasitären kapitalistischen Vampire im Kapital von Karl Marx und Draculas Residenz in Bram Stokers Schauerromanen, aber auch auf die verwinkelten und um sich selbst kreisenden Debatten im Internet.
Als Sympathisant der Occupy-Bewegung und der britischen Studierendenproteste von 2011 war Fisher ein Veteran jener digitalen linken Öffentlichkeit auf Twitter und Facebook, die zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen steckte. Sein Essay muss als Warnung und Bekenntnis gelesen werden – zwei Genres, die für das Schreiben im Netz charakteristisch sind. Er ist das Bekenntnis eines desillusionierten Online-Utopisten, der einst begonnen hatte, dieses Medium zu nutzen, um der Enge der traditionellen Printmedien zu entfliehen. Er ist aber ebenso eine Warnung an eine Linke, die bald darauf ihre großen populistischen Experimente angehen würde. Corbyn, Podemos, Sanders und sogar Syriza waren noch Jahre entfernt.
Schon damals gelang es Fisher, die strukturellen Probleme der neuen digitalen Zivilgesellschaft auf den Punkt zu bringen: Ein latenter wie unauslöschlicher Sadismus, eine Tendenz zur permanenten gegenseitigen Überwachung, ein spezifischer Mittelschicht-Moralismus und die Unfähigkeit, Klasse als von anderen Formen von Ungleichheit unterschieden zu begreifen.
Fisher hat die Schwäche der Linken niemals auf die Callout Culture zurückgeführt (Cancel Culture war damals noch kein gebräuchlicher Begriff, und ob er wirklich besser geeignet ist, diese Phänomene zu beschreiben, ist unklar). Ein Hindernis bildeten die von ihm analysierten Tendenzen aber allemal. Er sah sich mit einer Linken konfrontiert, die aus ihrer »selbstverschuldeten Unmündigkeit« ausbrechen wollte, aber kein geeignetes Mittel dazu fand. Die Folge war ein »Stalinismus ohne Utopie« oder ein Autoritarismus ohne Autorität. Man versuchte eine Partei- oder Bewegungslinie durchzusetzen, ohne eine Partei oder Bewegung zu haben, auf die man sich klar hätte beziehen können. Alles, was man hatte, war eine Vielzahl von Splittergrüppchen und informellen Netzwerken mit ihren jeweiligen charismatischen Influencern.

Der Essay ist zugleich eine der großartigsten Betrachtungen über die spezifische gesellschaftliche Form des Internets. Fisher selbst hatte sich begeistert in die Blogging-Kultur der frühen 2000er-Jahre gestürzt, deren Ad-Hoc-Posting den Stil seiner Texte nachhaltig geprägt hat. Ihm bot das Internet noch eine Alternative zur erstarrten kapitalistischen Medienlandschaft, in der linke Autorinnen und Autoren bestenfalls kleine Kolumnen schreiben konnten, ansonsten aber in sektiererische Kleinstblätter ohne jeden Einfluss verbannt waren. Als vergleichsweise neue Form zugänglicher Kommunikation schien das Internet diese Schranken zunächst zu durchbrechen. 2013 waren viele seiner Verheißungen aber bereits zweifelhaft geworden.
Heute liegen die populistischen Aufbrüche der Linken schon zehn Jahre zurück. Mark Fisher beging vor fünf Jahren, am 13. Januar 2017, tragischerweise Suizid. Sein Essay erreicht uns wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit, die doch auch die unsere ist.
Anton Jäger ist Ideenhistoriker und Autor des Buches »Hyperpolitik: Extreme Politisierung ohne politische Folgen« (Suhrkamp 2023).