22. März 2023
Souverän, solange der Chef nichts sagt
Axel Honneth sorgt sich in seinem neuen Buch »Der arbeitende Souverän« um die Demokratiefähigkeit der Arbeiter. Dabei übersieht er den Demokratieverdruss der Kapitalisten.
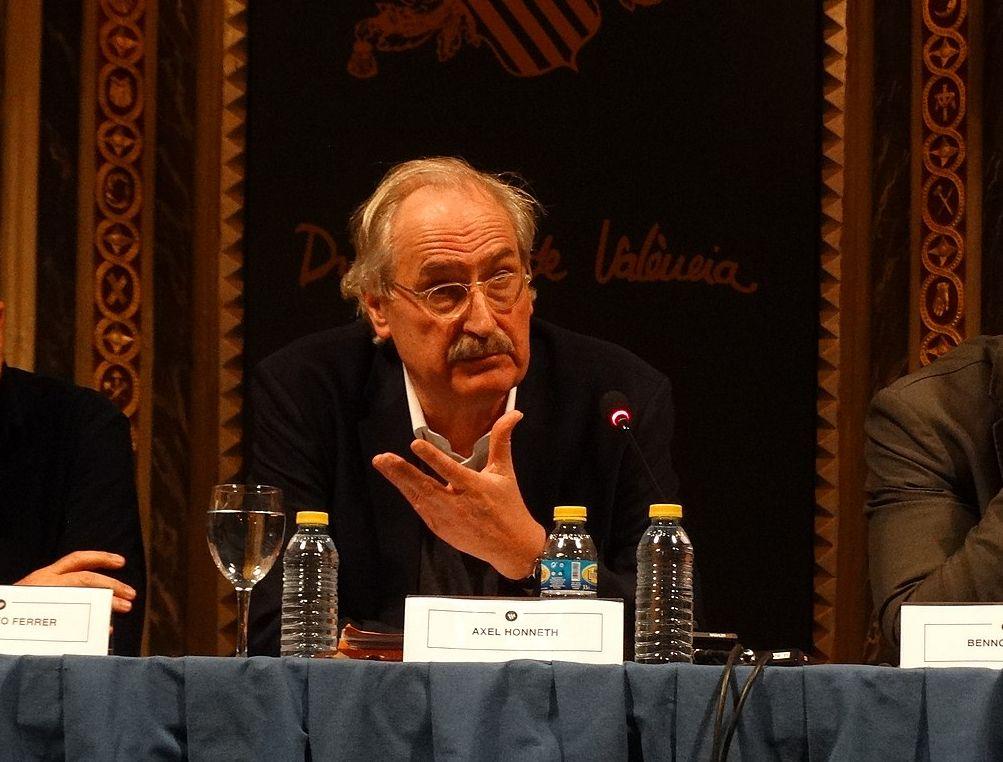
Axel Honneth bei einem Vortrag zu seinem Buch »Die Idee des Sozialismus«, 30. März 2017.
CC BY-SA 4.0Der arbeitende Souverän – das klingt vielversprechend. Axel Honneth, der langjährige Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, will mit seinem neuesten Buch die akademische Demokratietheorie daran erinnern, dass der Demos größtenteils aus arbeitenden Menschen besteht. Der Widerspruch von Demokratie und Kapitalismus ist keine Nebensächlichkeit, und es ist höchste Zeit, dass sich eine Größe der Kritischen Theorie seiner annimmt. Welche Schule könnte besser dafür geeignet sein als jene, die sich auf das Erbe sowohl der Aufklärung als auch des Marxismus beruft?
Was hat Honneth in diesem Buch also vor? Wird er untersuchen, was wir von Aufklärungsphilosophen wie Kondiaronk, Locke oder Rousseau lernen können für den ideologischen Kampf gegen die antidemokratischen Souveräne unserer Tage: Musk, Bezos, Gates? Wird er mit Feuerbach und Marx die Vorstellung auflösen, »die Wirtschaft« sei eine geheimnisvolle und von uns unabhängige Macht, wo sie doch in Wirklichkeit nichts anderes ist als das Zusammenwirken unserer eigenen Handlungen?
Nicht ganz. Denn Honneth ist sich unschlüssig, wie viel die Demokratie eigentlich in der Wirtschaft zu suchen hat. An dem argumentativen »Bollwerk« des Marktliberalismus, »dass für wirtschaftlichen Wohlstand und Effizienz der Preis zu zahlen sei, die Kontrolle von betrieblichen Abläufen und Investitionen privaten Akteuren zu überlassen«, sieht er kein leichtes Vorbeikommen. Eine »Widerlegung der Auffassung, wonach die politische und die wirtschaftliche Sphäre zwei gänzlich getrennte, funktional auf unterschiedliche Regeln angewiesene Subsysteme bilden, müsste eben erst geliefert werden«, wirft Honneth die Hände in die Luft, als hätte er auf den 400 Seiten nicht mehr als genug Platz, genau das zu leisten. Doch er hat etwas anderes vor.
Axel Honneth: Der große Zusammendenker?
Honneth unterscheidet drei Ansätze, die Arbeitswelt zu kritisieren. Als erste Tradition nennt er die Entfremdungskritik, die sich vor allem mit unmenschlichen und stumpfsinnigen Arbeitsbedingungen beschäftigt. Das zweite mögliche Argument lautet, dass Unternehmen genauso demokratisiert werden sollten wie Staaten – gemeinhin spricht man dabei von Wirtschaftsdemokratie, Honneth aber bezeichnet dies als den »republikanischen Ansatz«. Das Prädikat »demokratisch« hat er nämlich für den dritten Denkansatz reserviert, bei dem es sich zufälligerweise um seinen eigenen handelt.
Sein »demokratisches Paradigma« besagt, die Arbeitswelt müsse so eingerichtet werden, dass die Arbeitenden ungehindert an der demokratischen Willensbildung im Staat teilnehmen können. Dazu dürften sie weder unter zermürbenden Arbeitsbedingungen leiden, noch ihren Vorgesetzten komplett ausgeliefert sein. Für Honneth ist dieser Ansatz den anderen beiden klar überlegen, denn während sie sich wie mit Scheuklappen an nur je einem dieser Probleme abarbeiten würden, erlaube seine Rahmensetzung, die Ziele von guter Arbeit und Mitbestimmung im Betrieb zu verbinden. Sonderlich überzeugend ist das nicht.
Der Entfremdungstheorie Unvollkommenheit vorzuwerfen, ist einfach, aber auch ein bisschen unredlich. Sie basiert nämlich im Wesentlichen auf einem zu Lebzeiten unveröffentlichten Manuskript des jungen Marx, in dem das Konzept überhaupt nur zur Hälfte ausgearbeitet ist. Seine Kritik an entmenschlichenden Arbeitsverhältnissen, die heute als Inbegriff der Entfremdungstheorie gilt, ist dabei nur die eine Seite. Er kündigt an, das Phänomen auch eindringlich von der Seite der Kapitalisten zu betrachten – doch ehe er dazu kommt, endet das Manuskript.
»Es ist bedauerlich, dass Honneth offenbar glaubt, er müsse anderen Traditionen grundlegende intellektuelle Kapazitäten absprechen, um seinen eigenen Ansatz zu rechtfertigen.«
An einer anderen, weniger beachteten Stelle schreibt er andeutungsweise, die »besitzende Klasse« unterliege zwar auch der sozialen Entfremdung, fühle sich darin aber »wohl und bestätigt«, denn sie begreife »die Entfremdung als ihre eigne Macht«. Doch ausführen würde er diesen Gedanken erst später, und dann nicht mehr in der philosophischen Sprache der Entfremdungskritik, sondern im Rahmen seiner Kritik der politischen Ökonomie.
Dass die Herrschenden auch ein entfremdetes Leben führen, ist ein Gemeinplatz. Hingegen der Gedanke, dass genau in dieser Entfremdung ihre Macht liegt, ist vor dem Hintergrund der kanonisch gewordenen Entfremdungstheorie zumindest gewöhnungsbedürftig. Unvorstellbar war es für Marx aber offensichtlich nicht. Unvorstellbar ist dagegen, dass Honneth Marx ins Gesicht sagen würde, dass er Arbeitsbedingungen und Herrschaftsverhältnisse nicht zusammendenken konnte.
Dasselbe gilt spiegelverkehrt in puncto Wirtschaftsdemokratie. Honneth zufolge »besteht das entscheidende Manko der republikanischen Tradition darin, die Aufmerksamkeit so exklusiv auf die Abhängigkeit der Beschäftigten von privater Herrschaft zu richten, dass darüber die qualitative Seite der Arbeitsverhältnisse vollkommen aus dem Blick geraten muss«. Aber warum sollte das so sein? Es stellt sich ernsthaft die Frage, was die Beschäftigten denn seiner Meinung nach demokratisch mitgestalten sollen, wenn nicht ihre Arbeitsverhältnisse.
Das Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 – die bis heute weitreichendste Demokratisierung eines Wirtschaftszweigs in Deutschland – hat den Beschäftigten in den betroffenen Betrieben der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Bergbau, in denen bekanntlich raue Arbeitsbedingungen herrschen, selbstverständlich auch Verbesserungen in Sachen Arbeitsplatzgestaltung und Gesundheitsschutz gebracht. Würde Honneth dem damaligen DGB-Vorsitzenden Hans Böckler, der den Kampf für Wirtschaftsdemokratie zur Priorität machte, etwa unterstellen, dass er die Zielvorstellung »Wirtschaftsbürger« als reinen Selbstzweck verfolgte und nicht etwa, wie er selbst sagte, um »die Lebensmöglichkeit des gesamten Volkes zu verbessern«?
Der andere Grund, aus dem Entfremdungskritik und »republikanische« Kritik in Honneths Augen seiner eigenen Theorie nachstehen, ist ebenso zweifelhaft. Er behauptet nämlich, diese würden keine »Übergangsstufen«, sondern »nur Alles-oder-nichts-Zustände« kennen. Nur sein eigener Ansatz sei imstande, »in Graden« zu denken. Das soll er einmal dem Gewerkschaftsökonomen Rudolf Meidner erzählen, der in den 1970ern in Schweden buchstäblich ein gradualistisches Modell der Demokratisierung vorschlug, bei dem Jahr für Jahr Unternehmensanteile und damit verbundene Stimmrechte an die Arbeiterschaft übertragen werden sollten. Und da bei Marx das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln eine wesentliche Ursache für die entfremdete Arbeit darstellt, ließe sich argumentieren, dass der Meidner-Plan ebenso schrittweise die Entfremdung reduziert hätte.
Die Leerstelle: Der Demokratieverdruss der Herrschenden
Es ist bedauerlich, dass Honneth offenbar glaubt, er müsse diesen anderen Traditionen grundlegende intellektuelle Kapazitäten absprechen, um seinen eigenen Ansatz zu rechtfertigen. Denn das Konzept, das er selbst mit Rückgriff unter anderem auf Hegel und Durkheim vorstellt, ist für sich genommen vollkommen valide. Sein Grundargument lautet, dass es Menschen bei der politischen Partizipation im Staat beeinträchtigt, wenn sie durch ihre Arbeit physisch oder psychisch überlastet sind, die Willkür ihrer Vorgesetzten oder Arbeitslosigkeit fürchten müssen oder ihre Tätigkeit in der Gesellschaft keine Anerkennung findet.
Auch die Reformen, die er vorschlägt, um den arbeitenden Souverän zu stärken, sind absolut unterstützenswert. So tritt er anstatt für ein Bedingungsloses Grundeinkommen für eine Art gesetzliche Jobgarantie im öffentlichen Sektor ein, um Menschen effektiver vor gesellschaftlicher Isolation zu schützen. Auch schwebt ihm etwas wie ein verpflichtendes soziales Jahr vor, das nicht nur das Gemeinschaftsgefühl aller Teilnehmenden stärken, sondern zudem auch die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen entlasten und ihre Tätigkeit gesellschaftlich aufwerten würde. Und wenn es nach Honneth ginge, sollte auch die Gründung von Genossenschaften staatlich gefördert werden, weil Arbeiterinnen und Arbeiter in dieser Unternehmensform ein Maximum an demokratischer Verantwortung erfahren.
»Für eine mächtige Minderheit muss Demokratiefähigkeit noch etwas anderes bedeuten – nämlich den Willen der Mehrheit anzuerkennen, auch wenn er den eigenen Interessen und Vorstellungen zuwiderläuft.«
Was die Privatwirtschaft angeht, würde Honneth als allererstes den Niedriglohnsektor abschaffen und insgesamt am liebsten das gesicherte Normalarbeitsverhältnis der 1960er Jahre wiederherstellen. Und in Sachen Arbeitsgestaltung plädiert er dafür, extrem monotone Arbeiten durch Abwechslung mit angrenzenden Tätigkeiten zu bereichern und dem Trend der Individualisierung entgegenzutreten, indem man wieder verstärkt auf Gruppenarbeit setzt. Alledem kann man nur beipflichten. Zu kritisieren wäre dabei lediglich Honneths mitunter etwas paternalistisches Wording, wenn er etwa meint, die Arbeiterinnen und Arbeiter bräuchten solche kooperativen Arbeitsformen, um »demokratische Verhaltensweisen einzuüben« und »zu erlernen, was es heißt, sich in die Perspektive Anderer hineinzuversetzen«.
Honneth leistet mit seinem Buch einen wichtigen Beitrag zur Debatte – aber es ist eben nur ein Beitrag, nicht die Krönung des Ganzen. Aus einer marxistischen Perspektive auf Wirtschaftsdemokratie macht sich sein Ansatz nämlich einer schwerwiegenden Halbheit schuldig: Honneth sorgt sich um die Demokratiefähigkeit der Arbeiterinnen, schweigt aber über die Demokratiefähigkeit der Kapitalisten.
So wie er die Voraussetzungen für die aktive politische Teilnahme versteht, stellt sich die Frage auch gar nicht. Denn sicherer Lebensunterhalt, wirtschaftliche Unabhängigkeit, solides Selbstwertgefühl und »ein gewisses Quantum an arbeitsfreier Zeit« sind für Angehörige der besitzenden Klasse ziemlich selbstverständlich gegeben. Doch für eine mächtige Minderheit muss Demokratiefähigkeit noch etwas anderes bedeuten – nämlich den Willen der Mehrheit anzuerkennen, auch wenn er den eigenen Interessen und Vorstellungen zuwiderläuft.
Heute nutzen große Unternehmen und ihre Eigentümer immerzu antimajoritäre Machthebel, um Regierungen am demokratischen Prozess vorbei zu beeinflussen. Das können eher direkte Methoden wie der Lobbyismus sein oder weniger offensichtliche, wie die hinter vermeintlich objektiven Marktmechanismen verborgene Drohung, durch Kapitalflucht den Wirtschaftsstandort zu schwächen, wenn das nationalökonomische Klima arbeiter- oder umweltfreundlicher und damit weniger »investitionsfreundlich« wird.
Das Hauptproblem unserer Demokratie besteht eben nicht darin, dass sich die Menschen, die Tag für Tag schuften gehen, nicht in ihre gegenseitigen Lebenslagen hineinversetzen könnten. Vielmehr haben die Regierenden Schwierigkeiten, sich in Arbeiterschuhe zu versetzen. Dieses Problem kriegt man mit Honneths Methoden nicht gelöst – auch nicht, indem man mehr Gruppenarbeit im Bundestag einführt.
Beim Projekt der Wirtschaftsdemokratie geht es seit jeher auch darum, die antidemokratischen Mächte der Privatwirtschaft zu schwächen, die die politische Demokratie belagern. Wenn die Klasse der Bosse nicht entweder im Unternehmensinneren durch eine ermächtigte Arbeiterschaft in Schach gehalten oder äußerlich zum Beispiel durch staatliche Kapitalverkehrskontrollen eingeschränkt wird, wird es kaum möglich sein, Honneths Reformkatalog auch nur ansatzweise umzusetzen.
Thomas Zimmermann ist Print Editor bei JACOBIN.