15. April 2022
Techno-Ökologie
Den Klimawandel durch Algorithmen steuern? Das klingt verführerisch. Doch am Ende des Tages ist das weniger ein Triumph menschlicher Erfindungskraft als eine Kapitulation vor dem System, in dem wir leben.
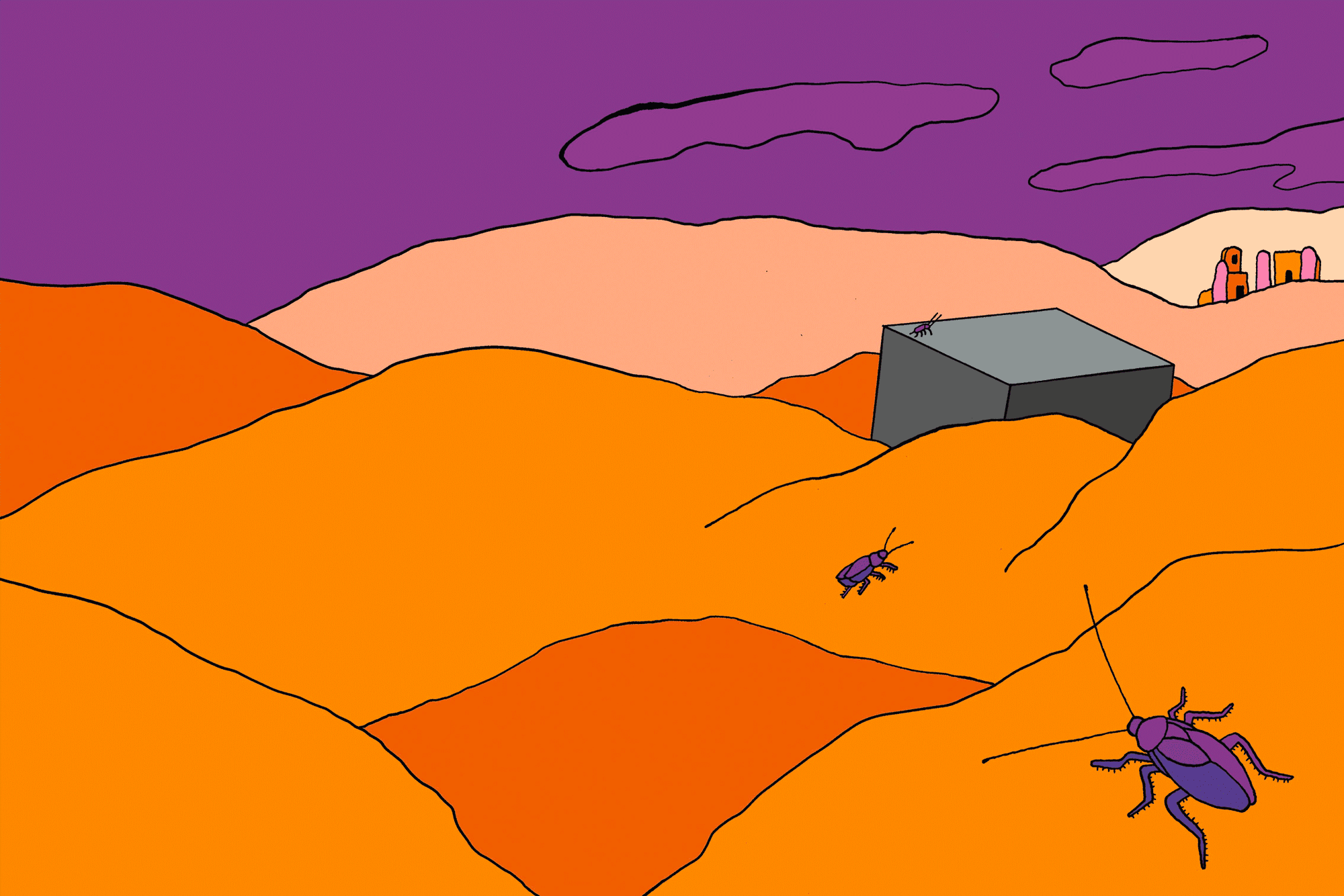
An einem abgelegenen Ort an der Küste Tasmaniens wird in den kommenden Monaten ein kolossaler Monolith aus Stahl fertiggestellt – zehn Meter lang, vier Meter hoch, drei Meter breit. In seinem Inneren werden Aufzeichnungsgeräte kontinuierlich Umweltdaten speichern, die das Fortschreiten des menschengemachten Klimawandels dokumentieren: den CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre, das Artensterben, die Landnutzung, das Bevölkerungswachstum, Temperaturveränderungen, den pH-Wert der Ozeane. Dieses massive, unzerstörbare Speichermedium soll selbst den Untergang unserer Zivilisation überdauern.
»Earth’s Black Box« heißt diese Konstruktion in Anlehnung an die Black Box eines Flugzeugs, die relevante Daten aufzeichnet, damit im Falle eines tödlichen Absturzes die Unfallursache rekonstruiert werden kann. Hinter dem Projekt stehen Wissenschaftlerinnen, Künstler und eine Werbeagentur, die mit diesem apokalyptischen Datenträger Verantwortliche in Politik und Wirtschaft zu resolutem Handeln motivieren wollen. »Eure Taten, Tatenlosigkeit und Interaktionen werden von nun an aufgezeichnet«, heißt es drohend auf der Website.
Fully automated algorithmic environmentalism
Bei allem Pathos wirkt Earth’s Black Box wie eine hilflose Reaktion auf die Diskrepanz zwischen dem technischen Monitoring des Klimawandels, das immer ausgeklügelter und komplexer wird, und der Trägheit des politischen Betriebs, der nur widerwillig auf die Alarmsignale reagiert, die sich aus all diesen Daten ergeben. Einige Ökologinnen, Landschaftsarchitekten, Künstlerinnen und Startups schlussfolgern daraus, dass man die Politik bei der Bewältigung der Klimakrise am besten gleich außen vor lassen sollte. Was der Mensch nicht richten kann, sollen nun Maschinen übernehmen.
Die Berliner Forschungsgruppe Terra0 arbeitet zum Beispiel an einem Prototypen zur algorithmischen Wiederaufforstung von Wäldern. Der Wald soll sich auf Basis der Blockchain-Technologie Ethereum selbst verwalten – ohne menschliche Intervention. Über Datenerhebungen und Satellitenbilder erkennt ein lernender Algorithmus, wo Saatgut benötigt wird und welche erkrankten Bäume abgeholzt werden müssen. In Brasilien will das Krypto-Unternehmen Moss Earth den Handel mit Emissionszertifikaten demokratischer, transparenter und weniger manipulierbar machen, indem es sie in handelbare Web3-Token umwandelt. Firmen wie das Regen Network wollen die Erderwärmung aufhalten, indem sie es Landwirten ermöglichen, nicht nur ihre Erzeugnisse, sondern auch Praktiken regenerativer Bodennutzung zu Geld zu machen: Die Förderung von Kohlenstoffbindung, Bodengesundheit und Artenvielfalt kann über die Blockchain des Regen Networks als Token monetarisiert werden, was Anreize für eine klimabewusste Agrarwirtschaft schaffen soll. Und es gibt Landschaftsarchitekten wie Bradley Cantrell, die computergestützte, responsive Landschaften entwerfen, die sich über künstliche Intelligenz selbst regulieren.
Solche Ansätze werden von der Idee geleitet, dass man den Menschen in Sachen Klimakrise nicht länger trauen kann – die Maschinen hingegen seien ideologisch unbefangen und könnten auf Basis von Datensätzen rationale Handlungsempfehlungen geben. Im Kern geht es also darum, die Klimafrage in eine Sphäre zu verlagern, die sich menschlicher Intervention durch politische Institutionen entzieht. Zur Lösung dieser Krise müsse sich der Mensch demütig zurückziehen und die Natur mittels menschgemachter Technologien ihre eigene Handlungsfähigkeit zurückgewinnen.
Hier vereint sich die technizistische Fantasie einer digitalen Weltmaschine mit einer romantisierten Naturvorstellung, in der uns die Welt als selbstbestimmte Akteurin entgegentritt. Der Philosoph Bruno Latour liefert den theoretischen Unterbau für solche Ideen, wenn er zum Beispiel erklärt, er sei von der Klimapolitik enttäuscht, weil diese zu anthropozentrisch sei und den Blick nur auf den Menschen, nicht aber auf die Erde selbst richte.
Spätestens hier zeigt sich: Bei aller technologischen Raffinesse sind diese Projekte von einer deprimierenden politischen Visionslosigkeit gezeichnet. Man kann sich offenbar so schlecht vorstellen, dass es eine kollektive menschliche Anstrengung geben könnte, die sich nicht in ökologisch destruktiven Kapitalinteressen ergeht, dass man noch eher fragt, welchen Willen Ökosysteme haben und wie man diesen Willen handlungsfähig machen kann. So beeindruckend die Technik, die diesen Entwürfen zugrunde liegt, auch sein mag – am Ende ist sie weniger ein Triumph menschlicher Erfindungsgabe als vielmehr eine Kapitulation vor dem System, das wir Kapitalismus nennen.
Sturm und Drang in Kalifornien
»I like to think of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony«, ist auf der Website der Forschungsgruppe Terra0 zu lesen. Es sind die ersten Zeilen des 1967 veröffentlichten Gedichts »All watched over by Machines of Loving Grace« der Hippie-Ikone Richard Brautigan. Es entwirft eine kybernetische Öko-Utopie, in der sich Natur und Computer in perfekter Harmonie vereinen.
Diese Sehnsucht nach wohlmeinenden Maschinen, welche die Welt zu einem besseren Ort machen würden, erwuchs kurioserweise aus der meistens nicht mit Hightech assoziierten US-amerikanischen Gegenkultur der 1960er Jahre. Einerseits richtete sie sich gegen die etablierte Politik, andererseits kamen sie und ihre technischen Innovationen dem Weißen Haus wie gerufen. Es war die Zeit des Systemwettkampfs und der Blockkonfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion. In einer Realität, die durch das atomare Wettrüsten und den Krieg in Vietnam von globalen Konflikten bestimmt war, bildete die Vorstellung der Welt als ein zirkulär vernetztes System, das über Informationsaustausch in perfekter Balance gehalten werden könne, eine utopisch scheinende, ideologische Alternative. Die heutigen Versuche eines sich selbst regulierenden Klimaschutzes speisen sich direkt aus dieser Ideologie einer durch Rückkopplungsschleifen von Informationsströmen optimierten Gesellschaft.
Beim Verbreiten dieser Vision spielte der Whole Earth Catalog eine zentrale Rolle. Das gedruckte Magazin richtete sich an die junge, rebellische Generation der 1960er, die im Kalten Krieg aufwuchs. Die Nachkriegsgesellschaft bot ihr bei allem materiellen Überfluss keine Erfüllung, sondern nur dröge Konformität und wurde von grauen Bürokraten verwaltet, die von ihren Eigeninteressen so verblendet zu sein schienen, dass sie nicht begriffen, dass sie mit der Atombombe alles Leben auf der Welt bedrohten – das war die Vorstellung. Die Gegenvision dazu bildete das freie Leben auf dem Land.
Anders als der Name vermuten lässt, war der Whole Earth Catalog kein Katalog, sondern eine Art analoges peer-to-peer Register, das praktische Utensilien, Tipps und Werkzeuge versammelte, die die Leserin für ein selbstgenügsames Leben in autarken Landkommunen fit machen sollte: Anleitungen zur Aufbereitung von Trinkwasser, Gas-Masken gegen Luftverschmutzung und neueste Computertechnik. Er bewarb auffällig wenige praktische Werkzeuge und Maschinen, die sich für das Leben auf dem Land sicherlich als nützlich erweisen würden, wie Traktoren oder Bewässerungsanlagen. Stattdessen – und das ist bezeichnend – empfahl er jede Menge Bücher, die einem das nötige Expertenwissen vermitteln sollten, um die Welt in ihrer systematischen Gesamtheit begreifen zu können.
Der Whole Earth Catalog liest sich heute wie ein Loblied auf die Kraft von Technologie und Expertise. Die empfohlene Lektüre gibt Aufschluss über die weltanschaulichen Vorstellungen hinter dem Projekt. Als besonders lesenswert galten etwa die Standardwerke der Kybernetik, Paul Ehrlichs The Population Bomb oder Atlas Shrugged, der letzte Roman der ultralibertären Ikone Ayn Rand. Der Whole Earth Catalog bot seinen Lesern so gewissermaßen auch eine weltanschauliche Bewusstseinsveränderung und propagierte eine Art potenzierte Do-it-Yourself-Ideologie. In seinem Grundsatzprogramm heißt es: »Wir sind schon wie Götter – dann können wir ebenso wohl gut darin werden. Inzwischen hat die Macht, wie sie von Regierungen, Konzernen, formaler Bildung und der Kirche aus der Ferne ausgeübt wird, so weit triumphiert, dass schwerwiegende Mängel die tatsächlichen Fortschritte in den Schatten stellen. In Reaktion auf dieses Dilemma entwickelt sich eine Sphäre intimer, persönlicher Macht.«
Um die Herrschaft der Institutionen und Autoritäten zu brechen, braucht es kein kollektives, politisches Subjekt mehr – man muss nur die gottgleichen Kräfte des Individuums entfesseln. Genau diesem Zweck dienen die Ideen und die Werkzeuge, die der Katalog verbreitet. Für heutige Ohren klingt das weniger nach sanftmütigen, Bäume-umarmenden Hippies und mehr nach wahnhaften Allmachtsfantasien. Das ganze Projekt wird animiert von einer Mischung aus grenzenloser Selbstüberschätzung, extremer Politikfeindlichkeit und naivem Weltverbesserungsethos. Der Medienwissenschaftler Fred Turner, der die Verbindungen zwischen den Hippies der 1960er Jahre und dem Unternehmergeist des Silicon Valley nachgezeichnet hat, beschrieb den Whole Earth Catalog einmal sehr treffend als Zeugnis einer Technokratie der Bohemiens.
Es mutet heute auf tragische Weise vorausschauend an, wenn Fred Richardson, einer der Mitherausgeber des Whole Earth Catalogs, darin die Schlussformel des Kommunistischen Manifests von der Vereinigung der globalen Arbeiterklasse kassiert und zugleich die heutige Atomisierung als Ideal zelebriert: »Workers of the world, disperse« – »Proletarier aller Länder, zerstreut euch«.
Auch die Covergestaltung ist aufschlussreich: Auf jeder Ausgabe ist ein Bild der Erde zu sehen, inmitten der Dunkelheit des Weltalls, aufgenommen von der NASA. Es scheint, als wollte es uns daran erinnern, dass es dem technologischen Fortschritt zu verdanken ist, dass wir nun aus der Gott-Perspektive auf die Welt blicken können. Gleichzeitig vermittelt uns dieses Bild eine Idee kosmischer Verbundenheit: Die ganze Welt ist eins. Ausgerechnet die Blaue Murmel der NASA – ein Symbol des vom Militär geförderten US-Raumfahrtprogramms und des Wettlaufs ins All gegen die Sowjetunion – sollte nun zum zentralen Motiv einer Weltanschauung werden, die politische Differenzen neutralisiert und durch die Vision eines ganzheitlichen Bewusstseins ersetzt, in dem es keine Gegner mehr gibt, sondern nur noch das planetare Ganze.
Wie selektiv und geschichtsvergessen dieser euphorische und technologiegestützte kosmische Blick schon damals war, markierte im Jahr 1970 das Spoken Word Gedicht »Whitey on the Moon« von Gil Scott Heron: Während die ersten Weißen auf dem Mond landen, versinkt die Schwarze Bevölkerung in Armut und Schulden. Der Whole Earth Catalog wollte seine Leserinnen und Leser trotzdem glauben lassen, dass alle in demselben Boot sitzen – oder besser gesagt: in demselben Raumschiff. Denn die Faszination für die Technologie und insbesondere die Raumfahrttechnik beschränkt sich nicht auf das Cover.
Bucky, der Weltdesigner
Um besser zu verstehen, wo dieser antipolitische Impuls und dieses übersteigerte Vertrauen in die emanzipative Kraft von Technologie und Design herrührt, lohnt sich ein Blick auf eine der Leitfiguren dieser Bewegung: Buckminster Fuller, der die Metapher vom »Raumschiff Erde« geprägt hat.
Fuller, der sich von seinen Fans gerne »Bucky« nennen ließ, war stolzer Kriegsveteran, ehemaliger Marineoffizier und Ingenieur, der in Anzügen und polierten Schuhen auftrat. Da mag es zunächst irritieren, dass er zur Galionsfigur der langhaarigen Hippies der 1960er Jahre wurde. Doch Fullers Entwürfe lebten von einem schwärmerischen Futurismus und seine Kernmotivation war es, die Lebensbedingungen aller Menschen zu verbessern.
Auch Umweltschützer fanden an ihm Gefallen, weil er über energieeffiziente Bauweisen nachdachte. So entwarf er etwa einen Prototypen für das sogenannte Dymaxion-Haus, das Ressourcen schonte und in Massen produziert werden konnte. Er träumte sogar davon, eine riesige Glaskuppel über ganz Manhattan zu konstruieren, um den Energieverbrauch einzudämmen und der Luftverschmutzung entgegenzuwirken. Fuller erdachte noch einiges mehr, etwa ein dreirädriges Auto oder eine neue Projektion der Weltkarte. Bekannt wurde er jedoch vor allem für seine geodätischen Kuppeln, die er allerdings nicht erfand, sondern nur weiterentwickelte und patentierte.
Die Bauweise der geodätischen Kuppeln war leicht, effizient und extrem stabil. Sie wurde daher vom Militär genutzt, um Radaranlagen zu behausen. Wenig später wurde sie auch zur präferierten architektonischen Form der US-amerikanischen Kommunenbewegung, denn die Kuppeln waren einfach zu bauen und ermöglichten maximalen Lichteinfall. Für Fuller waren das Wissen und die Technologien der Militärwissenschaften nicht nur eine destruktive Gefahr, sondern hatten auch ein utopisches Potenzial. Das Denken in Nationen und in Parteien hatte, so meinte Fuller, in der Welt nur zu Kriegen und Konflikten geführt. In seinen Augen brauchte es daher einen neuen Akteur, der diese Technologien einem anderen Zweck zuführt – eine Art planetaren Designer. Genau als solchen betrachtete Fuller sich selbst.
Fuller war nicht nur hoffnungslos politikverdrossen – man kann guten Gewissens sagen, dass er die Politik verachtete. Seine Vision des gesellschaftlichen Wandels beschrieb er besonders bezeichnend in seinem 1968 veröffentlichten Essay »What I am Trying to Do«: Er würde es vermeiden, sich in politische Kategorien wie links oder rechts einzuordnen, und sich stattdessen experimentell an Problemlösungen herantasten. Anstatt vergebens zu versuchen, die Gesellschaft zu verändern, wolle er die Umwelt der Gesellschaft neu entwerfen. Politiker seien allesamt Bürokraten mit Tunnelblick, die nur ihre persönliche Macht vergrößern und ihre partikularen Eigeninteressen bedienen würden. Um die Welt ins Gleichgewicht zu bringen, bräuchte es anstelle träger Parteipolitik innovative Visionäre, die in größeren Zusammenhängen denken – in ganz großen Zusammenhängen, um genau zu sein, nämlich in planetaren. Gefragt sei eine Figur, die die »physischen Praktiken« – also die natürlichen Gesetzmäßigkeiten unserer Welt – begreift und Technologien entwirft, die mit diesen im Einklang sind. Politik würde dann vollkommen überflüssig werden. Diese heilbringende Figur war er selbst, der »Comprehensive Designer«.
Fuller begriff diesen Welt-Designer als völlig unideologisch – die Probleme des Planeten lägen jenseits der Politik, schließlich ginge es ums Überleben aller. Um dieses zu gewährleisten, brauchte es nicht nur Kreativität und Erfindungsgabe, sondern auch Daten über die Gesetzmäßigkeiten der Natur, nach denen die Welt entworfen werden müsse, um die natürlich waltenden Kräfte in eine stabile Ordnung zu bringen. Dieser Anspruch ist ziemlich megaloman. Dennoch kann man sich kaum erwehren, sich hier und da auch von Fullers spielerischen Zukunftsideen und seinen bizarren Wortschöpfungen mitreißen zu lassen.
An der Figur des Comprehensive Designer zeigt sich, wie extrem funktionalistisch Fullers Denken war. Folgerichtig schrieb er dann auch kein politisches Pamphlet, in dem er seine Vorschläge für die Verbesserung der Welt vorstellte, sondern eine Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde. In diesem programmatischen Text, der in extrem schrulliger Prosa verfasst ist, behauptet Fuller, der Fortschritt der Technologie habe dazu geführt, dass nicht mehr herrische Könige und interessengeleitete Politiker die Geschicke der Menschheit in der Moderne lenkten, sondern wohlmeinende Planer, Architekten und Ingenieure.
Fuller warnte vor fossilen Brennstoffen und pochte auf regenerative Energiequellen sowie ein effizienteres Management der Ressourcen, damit das Raumschiff Erde nicht kaputt gehe. Er schrieb von den Fortschritten der Automatisierung, die uns früher oder später von der Arbeit befreien würden, und forderte angesichts dessen ein Grundeinkommen für alle. Fuller unterscheidet dabei nicht zwischen technologischem und gesellschaftlichem Wandel – er setzt sie gleich. Daher ist es auch nur konsequent, wenn soziale Probleme in allererster Linie als technologische gelten, die sich auf schlechtes Design zurückführen lassen und daher mit einem innovativen neuen Ansatz gelöst werden können. In Fullers Welt gibt es keine Antagonismen mehr – alle sitzen zusammen im Raumschiff Erde, das von visionären Innovateuren und technokratischen Planern gesteuert wird, die mit ihrem Expertenwissen den Überblick behalten. Eine treffendere Parabel auf die neoliberal-technologischen Antworten auf die Klimakrise gibt es kaum.
»Man ändert die Welt nicht, indem man die bestehende Realität bekämpft. Man verändert sie, indem man ein neues Modell entwickelt, das das bestehende Modell überflüssig macht«, konstatiert Fuller und klingt dabei wie ein Prophet des Design Thinking, jener boomenden Unternehmensstrategie, die vorgibt, alle Probleme der Welt mit Innovationskraft lösen zu können. Hier zeigt sich dasselbe blinde Vertrauen in die weltverändernde Kraft disruptiver Technologien, dieselbe Skepsis gegenüber der weltverändernden Kraft organisierter politischer Interessenkonflikte, dieselbe verblendete Hoffnung, dass sich alle Probleme lösen lassen, wenn nur die richtigen Leute lang genug brainstormen. Hier vereint sich eine antipolitische Can-Do-Attitüde mit einer naiven Vision planetarer Verbundenheit aller Menschen, die blind ist für die realen Machtasymmetrien unserer Welt.
Das erklärt auch, wie Fuller zur Kultfigur der landflüchtigen Hippies werden konnte: Auch sie hatten politischen Institutionen und sozialen Kämpfen den Rücken gekehrt, wollten andere, unbürokratische und freiere Gemeinschaften erzeugen, indem sie lediglich neue Umgebungen schufen. Funktioniert hat es nicht. Die meisten Kommunen gingen innerhalb von Monaten in die Brüche. So praktisch die Tools und so durchdacht die Designs auch gewesen sein mögen – um eine neue soziale Ordnung zu erschaffen, reichten sie nicht aus. Politik lässt sich nicht so leicht ersetzen.
Utopie ohne Subjekt
Die Vorstellung, dass wir bloß neue disruptive Technologien, zukunftsweisendes Design und ein Bewusstsein für unsere globale Verbundenheit brauchen, ist nicht nur ein Relikt des libertären Milieus um den Whole Earth Catalog. Diese antipolitische Vision der Gesellschaft hat in verschiedenen Formen bis heute überdauert: etwa in den techno-optimistischen Konzepten responsiver Landschaften oder den Krypto-Start-Ups, die mit der Blockchain die Erde retten wollen. Auch diese Ansätze basieren auf der Überzeugung, dass politische Institutionen der Verbesserung der Welt eher im Weg stehen, als sie zu ermöglichen.
»Die Hoffnung ist, dass sich alle Probleme lösen lassen, wenn nur die richtigen Leute lang genug brainstormen.«
Auf ideologischer Ebene entspricht dem die Vorstellung der Welt als Informationssystem, das sich am besten selbst reguliert und nicht durch zu viel politische Intervention aus dem Gleichgewicht gebracht werden sollte. Wer sich hier an neoliberale Glaubenssätze erinnert fühlt, nach denen am besten »der Markt regelt« und nicht der Mensch, weil jedwede wirtschaftliche Planung zwangsläufig den »Weg in die Knechtschaft« ebnet, liegt damit vermutlich nicht ganz daneben.
Der Technik-Determinismus unterliegt Konjunkturen: In den 1930er Jahren glaubte der Ökonom John Maynard Keynes, der industrielle Fortschritt würde seinen Urenkeln ein Leben jenseits materieller Knappheit und mit einem Überfluss an Freizeit ermöglichen (dann kam die Große Depression); Anfang der 1970er Jahre meinte der Soziologe Daniel Bell, die Informationstechnologien würden ein postindustrielles Zeitalter einläuten, in dem immer weniger Menschen in Fabriken arbeiten müssten (dann kam die Ölkrise); in den 1990er Jahren prognostizierte der Ökonom Jeremy Rifkin, die fortschreitende Digitalisierung würde Arbeit zunehmend überflüssig machen (dann platzte die Dotcom-Blase); und letztes Jahr verkündete die Sängerin Grimes auf Tiktok, künstliche Intelligenz sei die Schlüsseltechnologie für den Kommunismus.
Keine dieser Visionen hat sich jemals erfüllt. Dennoch besteht der Optimismus fort, dass die Technologie uns die Transformationen bringen wird, die wir brauchen. Als Sozialistinnen und Sozialisten dürfen wir selbstverständlich nicht davor zurückschrecken, neue Welten zu entwerfen und dafür auch alle technologischen Möglichkeiten nutzbar zu machen, die uns offenstehen. Wir sollten jedoch nicht in einen »Rechnermessianismus« verfallen, wie Dietmar Dath in seinem Essay Maschinenwinter warnt. »Politisch-ökonomische Fragen sind politisch-ökonomische Fragen; die Tautologie geht offenbar nicht nur Idealisten nicht ein, sondern auch Materialisten, die in ihren Sozialismus die alte bürgerliche Erbsünde des Glaubens an einen quasi naturgesetzlichen Fortschritt mitschleppen«, bekräftigt er an anderer Stelle. Wenn wir heute spekulativ über eine andere Zukunft nachdenken, sollten wir diesen Fehler vermeiden.
Was Fullers Design-Futurismus und die prototypischen Entwürfe eines automatisierten Klimaschutzes gemeinsam haben, ist der Glaube an einen subjektlosen Fortschritt. Aber was bringt es, von einer Welt zu träumen, in der wir die systemischen Beschränkungen unserer Gegenwart überwunden haben, ohne die Hürden mitzubedenken, die der Realisierung dieser neuen Welt im Weg stehen? Jeder noch so raffinierte Weltentwurf kann nur eine abstrakte Träumerei bleiben, solange es kein politisches Subjekt gibt, das ihn Wirklichkeit werden lässt. Eine solche Vision ist im Grunde hohl und politisch entkernt, denn sie definiert keine Akteurin, um die sich der anvisierte Wandel zentriert und die ihm eine Richtung geben kann. Wenn wir eine andere Realität als die kapitalistische anvisieren, dann ist diese Leerstelle keine Fußnote.
»One World« ist Schwachsinn
Im Geiste Fullers schreibt heute auch Latour, dass sich die ökologische Krise richtungspolitischer Zuordnungen von rechts und links entziehe – immerhin sei es die Erde selbst, die uns in dieser zivilisatorischen Krise als »das Terrestrische« entgegenschlage. Dieser Glaube, dass die Klimakrise jenseits des Politischen stünde, weil sie unser aller Überleben bedroht, verunmöglicht interessengeleitetes Handeln. Das ist vor allem deswegen so irreführend, weil es überhaupt erst interessengeleitetes Handeln war, das uns in diese Lage gebracht hat. Wie der Humanökologe Andreas Malm in seinem Buch Fossil Capital darlegt, war für den Aufstieg der Dampfmaschine und der fossilen Brennstoffe sowie für den Niedergang der Wasserräder weniger der technologische Fortschritt als solcher verantwortlich, als vielmehr eine kleine Clique britischer Unternehmer. Diese erkannte nämlich, dass die Kohlekraft im Vergleich zur Wasserkraft mehr unternehmerische Mobilität und besseren Zugang zu einer unterbezahlten industriellen Reservearmee eröffnete.
»Jeder noch so raffinierte Weltentwurf kann nur eine abstrakte Träumerei bleiben, solange es kein politisches Subjekt gibt, das ihn Wirklichkeit werden lässt.«
Heute wird die Dekarbonisierung vor allen Dingen durch die Interessen von Konzernen blockiert, die inmitten der Klimakrise weiterhin Profite einstreichen, während die Ärmsten am schwersten von ihren Auswirkungen betroffen sind. Dieser Konflikt wird damals wie heute ganz offensichtlich nach klassenpolitischen Parametern ausgefochten – und ausgerechnet jetzt verkündet Latour, dass die Trennung in politische Lager überkommen sei und schwadroniert stattdessen von einer »Geopolitik der Lebensformen«.
Wir sollten die Überwindung der Klimakrise deshalb nicht in moralische Appelle an das »Wohl des Planeten« und unsere globale Verbundenheit kleiden, denn das verschleiert den Antagonismus zwischen den Klassen, der sich in dieser Krise zuspitzt. Wie auch der marxistische Sci-Fi-Autor China Miéville in seinem Aufsatz »Limits of Utopia« schreibt, ist die Idee unserer planetaren Verbundenheit angesichts der voranschreitenden ökologischen Katastrophe ein Lüge: »Es gibt keine verbundene Welt, es gibt kein Wir ohne Sie.« Während wir an utopischen Gegenentwürfen feilen, leben wir längst in einer Utopie – »es ist bloß nicht unsere«, so Miéville. Es ist die Utopie derjenigen, die propagieren, dass es eben doch keine Alternative gibt. Wenn wir nicht vor dem Kapitalismus kapitulieren wollen, müssen wir uns von der Idee einer planetaren Verbundenheit, die alle Differenzen zunichte macht, endgültig verabschieden: Wir sitzen nicht alle im selben Boot, sondern befinden uns in einem harten Interessenkonflikt.
Die Vision der Erde als Ganzes kann ein Denken mobilisieren, dass uns Folgen unseres Handelns bewusst werden lässt, die weit abseits unseres Erfahrungshorzionts liegen. Darin liegt ihre potenziell vereinende Kraft – und zwar wenn sie auf der Einsicht beruht, dass es ein gemeinsames Klasseninteresse gibt, dass uns über Ländergrenzen hinweg miteinander verbindet. Ohne politische Institutionen, die unseren Interessen Kraft verleihen, kann jedoch dieselbe Idee globaler Verbundenheit einen Management-Ethos befördern, der uns glauben machen will, dass eine Riege von Expertinnen, Technologen und Designerinnen den Planeten retten kann, ohne dass sich an den Kräfteverhältnissen unserer Welt irgendetwas ändern müsste.
Die Vorstellung von sich selbst aufforstenden Wäldern und kybernetisch gesteuerten Naturschutzgebieten ist verführerisch. Wir sollten uns aber in Erinnerung rufen, was aus dem Projekt einer besseren Welt durch besseres Design geworden ist und warum sie uns keinen Weg in einen demokratischen Fortschritt weisen kann: Die Kommunen sind alle in kurzer Zeit zerfallen, denn in den unbürokratischen Hippie-Communities zog statt sozialer Harmonie individuelle Tyrannei ein, denen ihre Mitglieder in Abwesenheit formaler Strukturen hilflos ausgeliefert waren.
Die Annahme, dass die Technik allein einen Weg aus den Unzulänglichkeiten der Politik weist und sie am besten vollständig ersetzen sollte, hat heute im staatsfeindlichen Solutionismus des Silicon Valley ihren Gipfel erreicht. Im Kapitalismus schlummert die Technologie im »Maschinenwinter«, wie Dietmar Dath schreibt. Um sie nutzbar zu machen, muss auch sie erst befreit werden. Wenn wir uns darauf einigen, dass wir derzeit eine systemische Krise erleben, in der sich die Frage aufdrängt, wie wir in Zukunft wirtschaften, arbeiten und konsumieren wollen, müssen wir uns auch darüber klar werden, wer das Subjekt dieses Wandels sein kann – wohlmeinende Maschinen sind es jedenfalls nicht.
Astrid Zimmermann ist Contributing Editor bei Jacobin.