01. Mai 2020
Unser Weg zur Macht
Das 20. Jahrhundert hält für die sozialistische Bewegung viele Lehren bereit. Aber werden wir sie auch zu ziehen wissen?
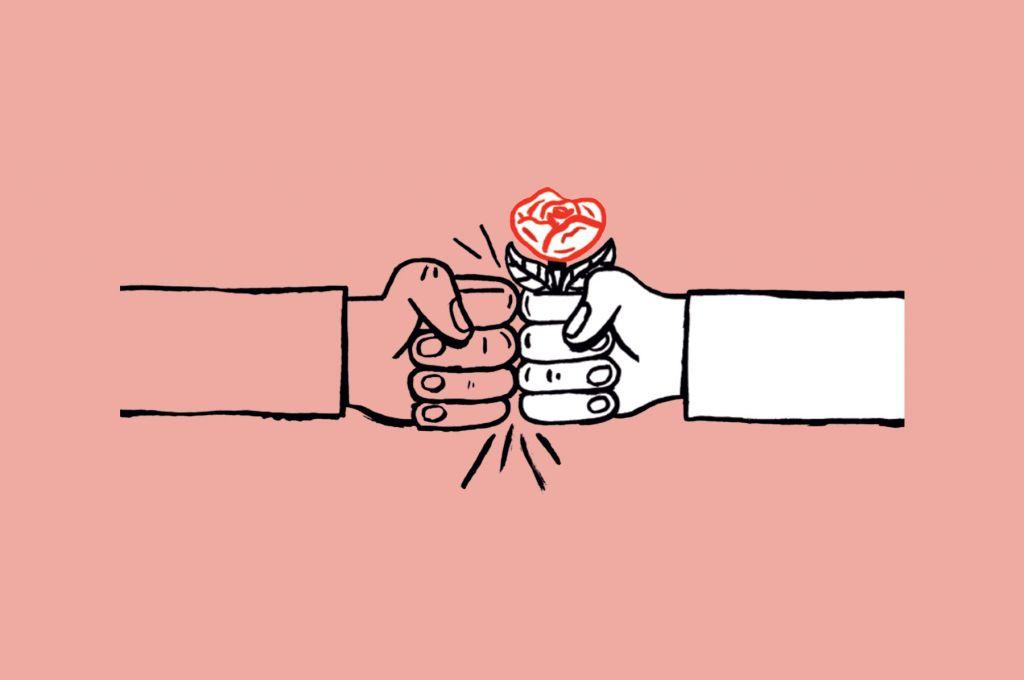
Hundert Jahre nach der Russischen Revolution befinden wir uns an einem Punkt, der in den letzten Jahrzehnten seinesgleichen sucht. Dass sowohl der Neoliberalismus als auch die traditionellen Parteien der Sozialdemokratie in Verruf geraten sind, eröffnet der radikalen Linken neue Möglichkeiten.
Jede Krise findet auf irgendeine Art ihre Lösung, und auch diese wird die ihre finden. Welchen Ausgang sie nimmt, hängt entscheidend davon ab, wie die Linke mit ihr umgehen wird. Die Krise könnte Ausgangspunkt eines neuen Zyklus von Organisierung sein – falls wir unsere Trümpfe richtig ausspielen – zur Wiederbelebung linker Parteien oder zur Gründung neuer Parteien führen.
Doch statt bloß nach vorn zu schauen, wollen wir einige Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Die Russische Revolution bleibt das ehrgeizigste Experiment sozialistischer Politik – und ihre Erfolge und Fehlschläge müssen Teil einer jeden Diskussion sein, in der es darum geht, wie sich die Linke wiederbeleben lässt. Doch nicht allein die russische Erfahrung gilt es zu beachten. Wir müssen das Experiment der Bolschewiki in die umfassende Geschichte sozialistischer Politik im 20. Jahrhundert einordnen – etwa neben die Lehren aus Chile, Deutschland und Schweden.
Allgemein gibt es zwei Vermächtnisse der Russischen Revolution – ein organisatorisches und ein institutionelles. Als organisatorisch bezeichne ich Fragen bezüglich der Formen kollektiver Aktion im Kapitalismus – Gewerkschaften, Parteien und dergleichen. Als institutionell bezeichne ich grundlegende Strukturen einer postkapitalistischen Gesellschaft – das politische System, die ökonomische Organisation und die rechtlichen Strukturen. Die organisatorische Dimension bezieht sich darauf, wie man Macht innerhalb des Kapitalismus aufbaut, und die institutionelle bezieht sich auf das, was nach dem Kapitalismus aufgebaut wird.
Organisatorisch
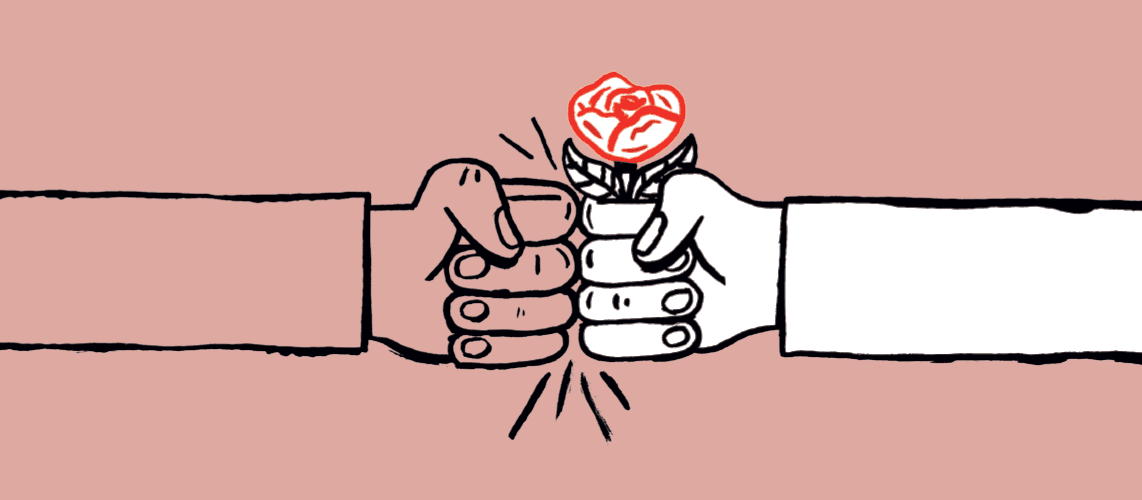
Struktur
In der Linken gibt es zwei Haltungen zur leninistischen Parteiorganisation. Auf der einen Seite erachtet man das Modell als ein Desaster – oder zumindest als eine negative Erfahrung. Die Anklage lautet, der Leninismus habe immer und überall im Autoritarismus geendet. Darauf reagieren die Anderen: »Das mag ja sein – doch ihr verwechselt Leninismus mit Stalinismus.« Mit anderen Worten: Es stimmt, dass mit dem Aufstieg Stalins die Debatten eingestellt wurden.
Diejenigen, die die leninistische Partei verteidigen, haben recht damit, dass sie in ihrem Anfangsstadium bemerkenswert offen und dynamisch war. Gleichzeitig bleibt die Tatsache bestehen, dass die globale Erfahrung seit den 30er Jahren in die entgegengesetzte Richtung wies – in Richtung der späteren, undemokratischen Form. So war die Partei Lenins sehr demokratisch, die Partei des Leninismus hingegen nicht. Und wir können die Schuld dafür nicht allein Stalin oder Sinowjew geben – oder wer auch immer der bevorzugte Bösewicht sein mag. Eine Parteiorganisation mit starken und widerstandsfähigen demokratischen Strukturen hätte ein vielfältigeres Ensemble an Erfahrungen hervorbringen sollen, keine einheitliche Geschichte der Verknöcherung.
Da dies nicht der Fall war, ist es einfach, zu dem Schluss zu kommen, dass die kommende Linke das leninistische Parteimodell ablehnen müsse – wie es die meisten Progressiven tun. Das Problem dieser Ansicht ist, dass kein anderes Modell auch nur annähernd so politisch wirkungsvoll gewesen ist. Alle vermeintlichen Alternativen, die seit den 60ern von der Linken entwickelt wurden – die pluralistischen Organisationen, die Organisationen der Horizontalisten, Anarchisten und ihrer Bezugsgruppen, die Bewegung der Bewegungen usw. – waren zwar in der Lage, eine begrenzte Zeit lang zu mobilisieren, hatten aber nur wenig Erfolg bei dem Versuch, Bewegungen nachhaltig zu stärken und noch weniger dabei, reale materielle Erfolge zu erringen. In der Tat war das auf Kadern basierende Modell dagegen derart erfolgreich, dass jede bedeutende, auf Massenmobilisierung zielende Partei des 20. Jahrhunderts es gewissermaßen nachahmte – sogar auf Seiten der Rechten.
Angesichts dieser Geschichte ist es schwer vorstellbar, dass die Linke nicht in irgendeiner Form jene Struktur des frühen Sozialismus wieder aufgreift. Will sie sich als wirkliche Kraft organisieren, muss sie das in einer Massenpartei tun, die sich auf Kader stützt und eine zentrale Führung und innere Kohärenz aufweist. Das muss zugegebenermaßen nicht zwangsläufig so sein – womöglich werden wir organisatorische Formen entwickeln, die offener und dezentraler sind und denen es trotzdem gelingt, Sachen gebacken zu bekommen. Doch in Anbetracht unserer Erfahrungen gibt es keine guten Gründe, unser bewährtestes Modell zurückzuweisen.
Wir müssen unseren Blick auf die frühen Jahre der Partei richten – also die Jahre vor 1918, bei denen alle darin übereinstimmen, dass die Partei zu dieser Zeit recht offen und demokratisch war – und diese genau studieren. Wir brauchen ein klares Verständnis davon, wie die Partei in diesen Jahren die Dynamik bewahrte, die sie zur erfolgreichsten Organisation ihrer Zeit machte – als Kritik an der Parteiführung als ein Recht angesehen wurde; als ein grundlegender Teil dessen, was es bedeutet, Parteimitglied zu sein. Gab es institutionelle Mechanismen, die diese Kultur von Debatte und Verantwortlichkeit schufen und die über die üblichen Methoden von Wahlen und Rundschreiben hinausgingen? Oder hing es letztlich schlicht von einer Führung ab, die sich diesen Werten verschrieb?
Wenn es institutionelle Mechanismen gab, die die Demokratie sicherstellten, könnten wir sie einfach übernehmen. Hängt die Frage aber von einer kontingenten internen Kultur ab, so bedeutet das, dass demokratische Praxis eine Form moralischer Hingabe erfordert, welche schwerer zu wiederholen ist, da Führungspersonen in der Regel dazu neigen, Demokratie abzubauen, statt sie zu befördern. Genau deswegen ist es wichtig, diese Lektion zu lernen und die wirkliche Praxis zu untersuchen, um zu sehen, wo diese Demokratie herrührte.
Basis
Die zweite organisatorische Frage betrifft das Verhältnis der Partei zu ihrer Basis. Hier können wir einiges von der Russischen Revolution lernen. In der Geschichtsschreibung des Kalten Krieges werden die Bolschewiki so dargestellt, als hätten sie die Macht durch eine Art Putsch errungen. Es wird behauptet, sie hätten nicht wirklich eine Massenbasis gehabt, sondern seien eine kleine Gruppe fanatischer Ideologen gewesen, die eine Diktatur verhängten. Doch zeitgenössische historische Studien konnten in beeindruckendem Detailreichtum zeigen, dass der Hauptgrund für die bolschewistische Machtübernahme und -erhaltung darin bestand, dass sie von allen Parteien in Russland die tiefsten, stärksten und festesten Verbindungen zur arbeitenden Klasse in den großen industriellen Zentren des Landes hatten. Das führte dazu, dass sie sich in den Monaten vor der Machtübernahme der Veränderungen in deren politischer Stimmung – besonders in Petrograd, aber auch in Moskau – am meisten bewusst waren. Das versetzte sie in die Lage, die Situation zu begreifen und Slogans und Programme zu entwerfen, die das Bewusstsein der Bevölkerung erfassten.
Die Bolschewiki waren mit dieser Ansicht nicht allein. In der Zwischenkriegszeit wurde von allen sozialistischen Parteien als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Grundlage ihrer politischen Strategie im alltäglichen Leben ihrer Basis verankert sein müsse. Und das nicht nur im Westen. Dies war die notwendige Voraussetzung des Sozialismus auf der ganzen Welt. Und es funktionierte. Die große Ära der sich ausbreitenden linken Bewegung von den frühen 1900ern zu den frühen 50er Jahren war möglich, weil die Parteien aus und für die arbeitenden Massen bestanden.
Diese Strategie war aus verschiedenen Gründen erfolgreich. Erstens und zuvorderst ermöglichte sie jenen Organisationen, Programme zu entwickeln, die die wirklichen Interessen ihrer Basis vertraten, da die Partei in einem beständigen Austausch mit ihr stand – da sie Seite an Seite mit der Basis im Alltag, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft kämpfte. Zweitens verlieh es dem Parteikader enorme Legitimität auf Seiten der Massen, dass sie mit ihnen durch dick und dünn gingen. Diese Legitimität war wesentliche Bedingung für das Vorantreiben des politischen Kampfes: Wenn die Kader ihre Basis ermutigten, welche Art von Aktion auch immer aufzunehmen, so konnten sie auf das Vertrauen und die Unterstützung zählen, die sie benötigten, um erfolgreich zu sein. Drittens beförderte diese tiefe und organische Verbindung auch eine lebhafte interne Kultur – eine Kultur der Demokratie und der Rechenschaftspflicht. Eine Partei, die mit dem alltäglichen Leben und dem Kampf der arbeitenden Klasse verflochten war, konnte nicht nur eine demokratische Kultur entwickeln, sondern auch Nutzen aus ihr ziehen. Schließlich stellt eine demokratische Kultur eine der wesentlichen Vorbedingungen dar, um das Vertrauen und die Unterstützung der Klasse zu gewinnen. Eine feste Basis zu haben, garantierte zwar noch nicht den Erfolg, ihr Fehlen jedoch garantierte Scheitern und Marginalisierung.
Offensichtlich unterscheidet das die meisten der frühen sozialistischen Parteien von den heutigen linken Gruppen im Westen. Die sozialistische Linke ist nur noch spärlich mit den Gemeinschaften der arbeitenden Klasse verbunden, wenn überhaupt. Im Großen und Ganzen ist sie strukturell von den arbeitenden Menschen getrennt und agiert meistens in kleinen Gruppen innerhalb der Milieus der Mittelschichten – an Universitäten, in NGOs, Studiengruppen und so weiter. Dies hat mehrere Konsequenzen: In erster Linie kann sie, anders als die traditionelle sozialistische Linke, die arbeitende Klasse im Kampf nicht wirklich organisieren und anführen, da sie physisch von ihr getrennt ist. Der überwältigende Teil ihres politischen Engagements fällt unterstützend und reagierend aus – sie taucht am Streikposten auf, um Zuspruch zu geben, verbreitet Nachrichten oder trommelt Sympathien zusammen. Aber das bedeutet, dass sie völlig abhängig von anderer Leute Organisationsarbeit ist und damit nicht in der Lage, selbst einen Kampf anzuleiten.
Zweitens bedeutet diese Beschränkung, dass die heutige Linke, um ihr sozialistisches Engagement aufrechtzuerhalten, ihre Mitglieder dazu erziehen muss, die Interessen einer anderen Klasse nachzufühlen und sie in ihrer Unterdrückung zu bemitleiden. Dies unterscheidet sie erheblich von den traditionellen linken Parteien, die sich im Milieu der arbeitenden Klasse selbst bewegten, somit in der Lage waren, sich aus ihr heraus zu rekrutieren und von daher ihre Mitglieder dazu befähigen konnten, für ihre eigenen materiellen Interessen zu kämpfen. Für diese früheren Gruppen war der Kampf eine Notwendigkeit, weil sie für den Lebensunterhalt und das Wohlergehen ihrer eigenen Mitglieder kämpften.
Die heutigen Gruppen müssen sich größtenteils ausmalen, was jene Interessen denn sein könnten, da sie aus ihrem direkten Engagement nichts darüber erfahren können. Oft geschieht dies, indem über vergangene Ereignisse nachgelesen und dann versucht wird, Parallelen zur gegenwärtigen Situation zu finden. Es ist jedoch schwer, auf diese Weise eine Strategie zu entwickeln. Es ist fast unmöglich, erfinderisch zu sein, da die meisten Mitglieder Veränderungen am Arbeitsplatz weder selbst erleben, noch in der Lage sind, neue Ansätze zu erproben. Das führt zwangsläufig zu einem gewissen Dogmatismus, weil das einzige Vertraute das ist, was früher einmal funk-tioniert hat.
Langfristig ist ein Resultat dieser Isolierung von den arbeitenden Menschen, dass die Organisationen zum Hort für Lifestyle-Politik moralisch inspirierter Studierender und Fachleute wurden. Sie geben ihren Mitgliedern das Gefühl, an den Veränderungen beteiligt zu sein – doch ihr Einsatz ist höchst individualistisch und größtenteils auf symbolische Akte der Solidarität beschränkt. Da echte Organisationsarbeit für gewöhnlich vom Tisch ist, richtet sich die Energie nach innen, auf die Kultur und die Eigenheiten der Gruppe. Wer aus Ländern mit radikaleren politischen Traditionen in die Vereinigten Staaten kommt, den muss es wie einen Schlag treffen, wie schrill, moralisch und letztlich unpolitisch die Debatten innerhalb der amerikanischen Linken sind. Sie tendieren dazu, Sprache, individuelle Identität, Körpersprache, Konsumgewohnheiten und dergleichen in den Fokus zu rücken. Das ist das Resultat einer »Linken«, die in der Tat aus Kleingruppen von Leuten mit bürgerlichem Hintergrund besteht, die in keiner organischen Weise Klassenpolitiken ausbilden können. Dieser Zustand währt nun schon so lange, dass allein die Idee, in der arbeitenden Klasse verankert zu sein, entweder als kurios oder unnötig erachtet wird.
Wenn die Linke irgendetwas erreichen will, wenn sie ihre frühere Rolle als Motor sozialer Gerechtigkeit zurückgewinnen will, wird ihr das nur gelingen, indem sie wieder in die Lebenswelten der Arbeitenden zurückfindet. Bis heute hat noch niemand zeigen können, dass Veränderungen in der nötigen Größenordnung – die Menschen über die Profite zu stellen, die Umwelt zu retten und die soziale Unterdrückung auszumerzen – anders erzielt werden können, als dadurch, sich mit dem Kapital anzulegen. Und wie soll das gelingen, wenn nicht das Vermögen derjenigen sozialen Kraft erschlossen wird, die allein das Kapital unter Kontrolle zu bringen vermag – der Klasse, die die Profite erzeugt?

Dieser Artikel ist nur mit Abo zugänglich. Logge Dich ein oder bestelle ein Abo.
Du hast ein Abo, aber hast dich noch nicht registriert oder dein Passwort vergessen?
Klicke hier!
Vivek Chibber ist Professor für Soziologie an der New York University, Herausgeber von »Catalyst: A Journal of Theory and Strategy« und Autor unter anderem von »Das ABC des Kapitalismus«, das bei Brumaire erschienen ist.