14. Dezember 2023
Das Wagenknecht-Paradox
Warum eine neue Partei um Sahra Wagenknecht vor allem der AfD schaden könnte.
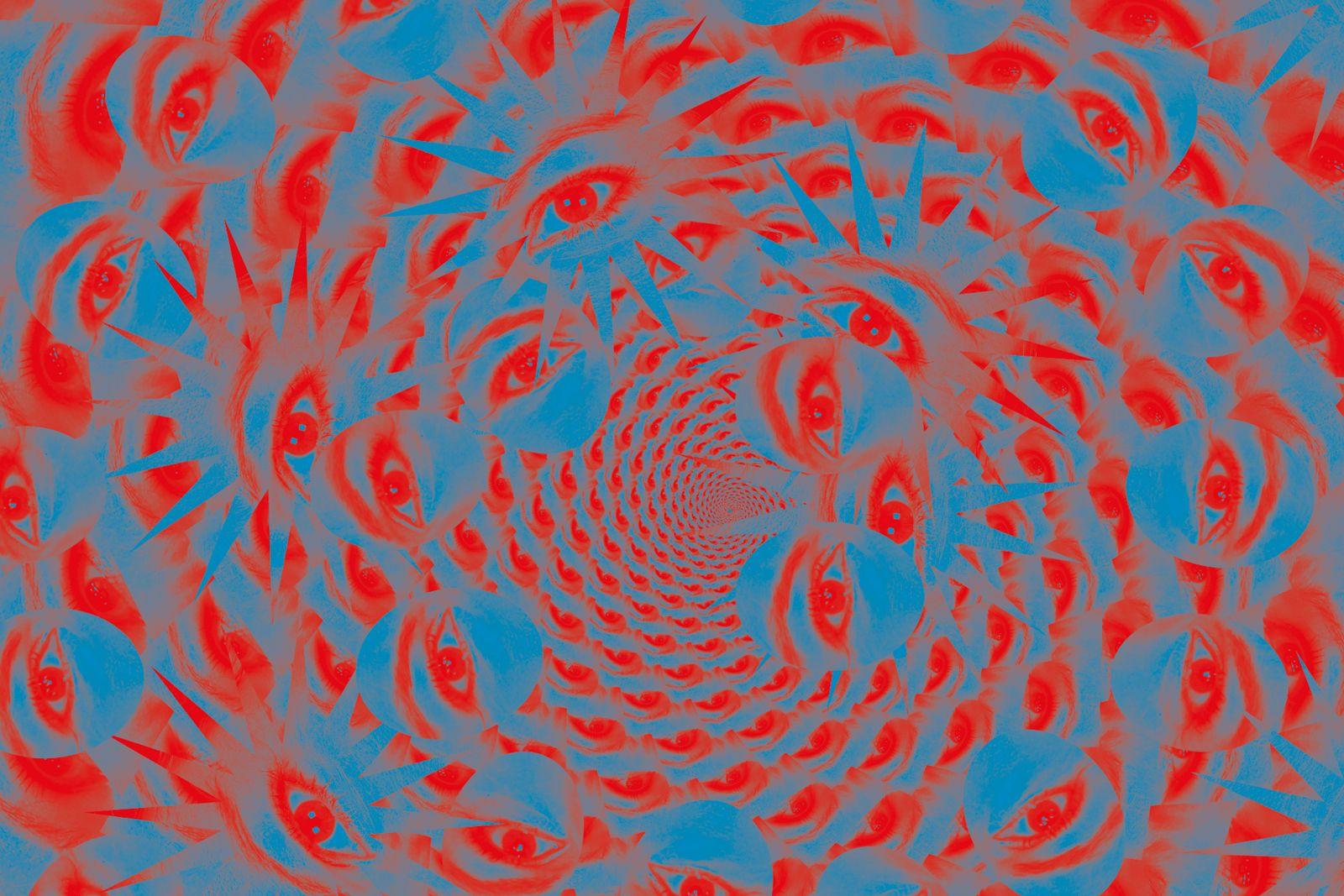
»Die Bevölkerung ist der Parteisoldaten überdrüssig und liebt von jeher Persönlichkeiten, die sich auch gegen ihre eigenen Parteien profilierten.«
Gegenwärtig lässt sich kaum erahnen, wie die politische Landschaft Deutschlands in einem Jahr – nach der Europawahl im Frühling und richtungsweisenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst – aussehen wird. Das liegt vor allem an Sahra Wagenknecht und ihrem Versuch, eine neue Partei aufzubauen. Ein Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte Umfragen zufolge mehr als 10 Prozent erhalten, im Osten sogar mehr als 20 Prozent. Laut Meinungsforschung spricht sie Wählerinnen und Wähler aller Parteien an, vermutlich könnte sie auch Menschen mobilisieren, die vorher gar nicht wählen gegangen sind – vor allem aber solche, die zuletzt ausgerechnet bei der AfD ihr Kreuzchen gesetzt haben.
Bekanntlich ersetzen Umfragen keine Wahlen und Zahlen keine Erklärungen. Um die Frage zu beantworten, warum die neue Partei einer einstigen LINKEN-Politikerin vor allem den Rechten schaden könnte, muss man die Situation analysieren. Dabei handelt es sich nämlich um einen sogenannten populistischen Moment. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass sich drei Hauptentwicklungen überschneiden: eine ökonomische Krise, eine politische Krise und wachsendes Misstrauen in signifikanten Teilen der Bevölkerung gegenüber den etablierten Parteien. Einen solchen populistischen Moment gab es etwa in einigen südeuropäischen Staaten im Zuge der Euro-Krise vor etwa fünfzehn Jahren.
Die politische Krise und das wachsende Misstrauen in der Bevölkerung wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon oft diagnostiziert und mit Begriffen wie »Politikverdrossenheit« und »Postdemokratie« zu fassen versucht. In Zeiten, in denen die Zustimmungswerte für die Ampel-Regierung auf einen historischen Tiefstand gesunken sind, gleichzeitig aber der Union – immerhin noch stärkste Oppositionskraft – ebenfalls keine bessere Politik zugetraut wird, vertieft sich die Krise des Parteiensystems, während die Anti-Establishment-Haltung im Wahlvolk steigt. Das liegt auch an der ökonomischen Krise, die sich nach Jahren relativer Stabilität nun Bahn bricht. Im Ergebnis von Krieg, Sanktionen und Gegensanktionen sowie den Nachwirkungen der Pandemie findet eine schleichende Verarmung breiter Bevölkerungsteile statt und grassiert auch unter gutverdienenden Arbeiterinnen und Arbeitern die Angst vor Deindustrialisierung, Arbeitsplatzverlust und sozialem Abstieg.
Anti-Establishment gewinnt
Von diesem populistischen Moment profitiert bislang vor allem die rechtsradikale AfD, die seit Sommer 2022 ihre Anhängerschaft mehr als verdoppeln konnte. Ihr aktueller Erfolg ist auch darauf zurückzuführen, dass sie in den Krisen der Vergangenheit oft als die einzige oder konsequenteste Opposition erschien: in der »Flüchtlingskrise«, als sie Abstiegsängste gegen Migranten ausspielte; während der Corona-Pandemie, als sie die Unzufriedenheit mit Lockdowns und Impfpflichtdebatten bündelte; und auch heute während des Ukraine-Kriegs, da sie sich als eine Friedenspartei geriert, die sich gegen Waffenlieferungen und für Verhandlungen ausspricht. Obwohl ihre Wirtschaftspolitik vor allem der Kapitalseite zugutekommen würde, erweckt die AfD mittels ihrer Kulturkampfrhetorik immer wieder erfolgreich den Anschein einer Anti-Establishment-Kraft.
So haben wir es beim aktuellen populistischen Moment mit einer rechtsdrehenden Spirale zu tun. Je mehr die AfD als negativer Bezugspunkt aller anderen Parteien dient, desto effektiver nutzt sie dies für sich aus. Wenn das Establishment und allen voran die als links wahrgenommene und verhasste Ampel gegen die AfD ist, dann muss diese in den Augen vieler Menschen, die die herrschende Politik als gegen sich gerichtet begreifen, doch auf ihrer Seite stehen. Vielen, die sich im Kapitalismus und gegenüber der herrschenden Politik ohnmächtig fühlen, gibt es ein Gefühl der Selbstermächtigung, die Stimme einer Partei zu geben, vor der das mediale und politische Establishment solche Angst hat, wie sie es in der zweiten Hälfte der 2000er-Jahre noch vor der LINKEN hatte.
Die Linkspartei konnte in den nunmehr sechzehn Jahren seit ihrer offiziellen Gründung 2007 kein Kapital aus den vielfältigen Krisen schlagen. Obwohl ihr Programm das mit Abstand systemkritischste ist und ihre Wahlkampfstrategien klassenpolitisch fundiert sind, wird sie oft als eine nur etwas linkere Variante von Grünen und SPD wahrgenommen. Vielen erscheint die LINKE inzwischen als Teil des Establishments, wohl auch weil sie in den Hochphasen der vergangenen Krisen zu zahm und zu staatstragend agiert hat.
»Ob BSW ein linkes Projekt wird, hängt davon ab, inwieweit gewerkschaftliche Stimmen in der neuen Partei Gehör finden.«
Das gilt indes nicht für Wagenknecht, die sich, was auch immer man von ihr halten mag, als Anti-Establishment-Populistin etablieren konnte. Dabei ist paradoxerweise keine andere (Ex-) LINKEN-Politikerin so sehr Teil der medialen Elite wie sie. Dies ist jedoch kein Widerspruch. Sie wird nicht nur wegen ihrer Schlagfertigkeit und ihrem Bekanntheitsgrad eingeladen, sondern auch, weil ihre Zuspitzungen Talkrunden unterhaltsamer machen und den Sendern damit Quote bringen.
Wagenknecht wirkt authentisch und inszeniert sich in Debatten um die Migrationspolitik, während der Corona-Pandemie oder zum Ukraine-Krieg als die Unbeugsame. Dies könnte auch einer der Gründe sein, warum sie trotz ihrer heutigen ordoliberalen Wirtschaftspositionen bei einigen Parteilinken nach wie vor hohes Ansehen genießt. Und nicht nur bei ihnen: Die Bevölkerung ist der Parteisoldaten überdrüssig und liebt von jeher Persönlichkeiten, die sich auch gegen ihre eigenen Parteien profilierten – von Heiner Geißler, dem Kapitalismuskritiker der CDU, über Wolfgang Kubicki, der sich gerne als FDP-Rebell inszeniert, bis eben zu Sahra Wagenknecht.
Kulturkampf oder Klassenpolitik
Eine Wagenknecht-Partei hat das Potenzial, sich der aktuellen Dynamik zu entziehen. Diese ist durch eine Polarisierung zwischen einem progressiv erscheinenden Regierungsestablishment und einer rechtsradikalen Alternative geprägt, wobei die Union, magnetisch vom rechten Pol angezogen, dazwischen changiert. Sollte der Parteiaufbau gelingen, könnte sich um Wagenknecht ein diffuses populistisches Projekt formieren, das sich nicht eindeutig dem linken oder rechten Spektrum zuordnen lässt. Es könnte sich aber auch um ein Parteiprojekt mit einem strukturell linken Vorfeld handeln, das sich auf die verteilungspolitische Lücke im Parteiensystem konzentriert.
Es besteht die ernste Gefahr, dass Wagenknecht vor allem versuchen könnte, die nicht unerhebliche Wählerschaft aus dem rechten Spektrum mit Nationalismus, Anti-Migrations-Rhetorik und kulturkämpferischen Tönen an sich zu binden. Ob BSW stattdessen ein linkes Projekt wird, hängt davon ab, inwieweit gewerkschaftliche Stimmen in der neuen Partei Gehör finden. Dazu muss Wagenknecht auch den offenkundigen Widerspruch, einerseits für höhere Löhne, Tarifbindung, Renten und andererseits für bessere Bedingungen für mittelständische Unternehmen zu sein, zugunsten der arbeitenden Menschen auflösen.
Sollte der Idealfall eintreten und sich um das Parteiprojekt eine im Kern klassenpolitische Bewegung entwickeln, die sich gegen die »Phantasielosigkeit der Etablierten«, wie der Historiker und Politikwissenschaftler Hans-Jürgen Puhle es einmal treffend beschrieb, und für notwendige Erneuerungen einsetzt, dann könnte die gesellschaftliche Linke, Linkspartei und SPD-Linke insgesamt profitieren. Eben weil Wagenknecht bemüht ist, nicht als linke Kraft wahrgenommen zu werden und gesellschaftspolitisch konservativ tönt, ist sie eine größere Konkurrenz für Rechte als für Linke. Umfragen deuten darauf hin, dass die LINKE kaum Stimmen an BSW verlieren würde, da ihre Wählermilieus sich zu sehr unterscheiden.
So schwer verdaulich viele Aussagen Wagenknechts sind, mit denen sie im AfD-Lager fischt und Ressentiments gegen Migranten nährt, könnte sich eine neue Partei mit ihr im Zentrum erheblich auf den populistischen Moment unserer Tage auswirken. Der Aufstieg der AfD könnte gebremst, vielleicht sogar gestoppt und die gesellschaftliche Debatte zu jenen sozioökonomischen Fragen zurückgeführt werden, in denen die Linke stark ist und deren Nichtbearbeitung durch das Establishment dem Faschismus den Boden bereitet. In Wagenknechts widersprüchlichem Projekt wäre eine solche antifaschistische Funktion nicht das einzige Paradox.
Sebastian Friedrich ist Autor und Journalist aus Hamburg.
Ingar Solty ist Publizist und Autor von Trumps Triumph?, Der postliberale Kapitalismus und der Edition Marxismen, einer 36-bändigen Reihe mit Einführungen in die Klassiker des marxistischen Denkens von Karl Marx bis Anwar Shaikh.