13. Juni 2021
Wollen wir wirklich Arbeitern beim Arbeiten zusehen?
Vom Kino über die Klassengesellschaft können wir mehr erwarten.
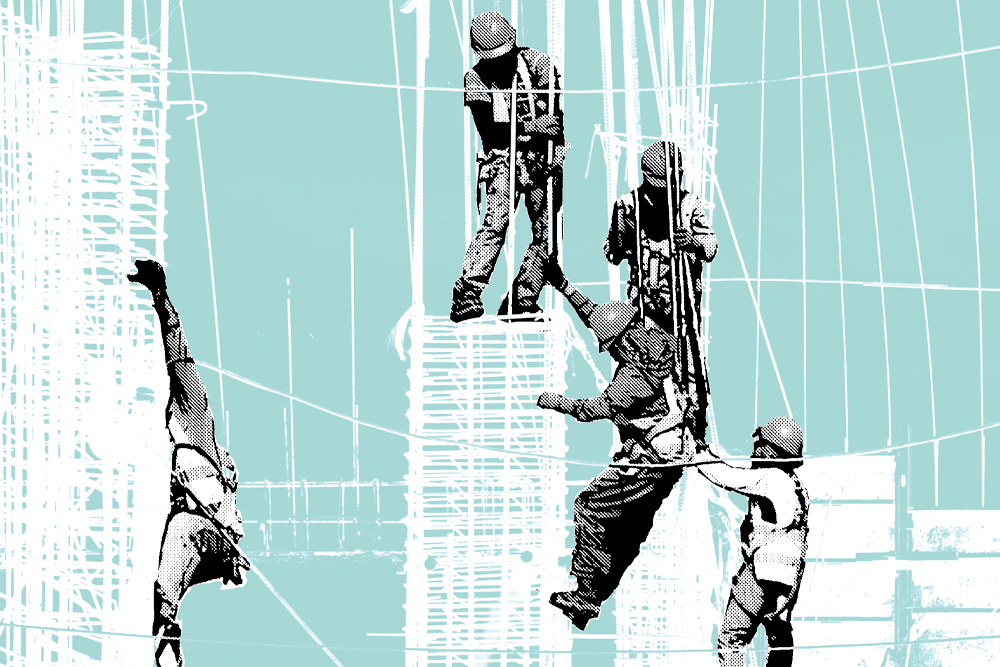
Ist das die ausgleichende Gerechtigkeit? Die einen müssen diese Arbeit tun, die anderen sie sich ansehen?
Die Arbeit und jene, die sie verrichten, sind im Hollywoodfilm stark unterrepräsentiert. Darüber wird selten gesprochen, obwohl die Diskurse um Repräsentation derzeit sehr dominant sind. Inzwischen haben Preise wie die Oscars, aber auch einige deutsche Filmförderinstitutionen Diversity unter ihre Kriterien aufgenommen. Dabei liegt der Fokus auf gender und race, die Kategorie class jedoch spielt überhaupt keine Rolle – weder am Set noch auf der Leinwand wird eine Arbeiterquote verlangt. Dass der Proletarier Jack in Titanic untergehen muss, das Upper-Class-Girl Rose aber gerettet wird, und der Haijäger und Kriegsveteran Quint in Der Weiße Hai von eben diesem gefressen wird, der Akademiker Hooper und der Polizeichef Brody hingegen überleben, ist typisch für Hollywoods Umgang mit der Arbeiterklasse.
Zwar stammen einige Hollywood-Größen selbst aus dem Proletariat – wie der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Tom Cruise –, jedoch täuschen solche Aufstiegsgeschichten kaum darüber hinweg, dass in der Filmindustrie häufig clanartige Strukturen vorherrschen. Familiendynastien, die mitunter noch auf Stummfilmzeiten zurückgehen, sorgen in Hollywood dafür, dass auch der mindertalentierte Nachwuchs zum Star gemacht wird. Darüber hinaus ist der Besuch einer Schauspiel- oder Filmhochschule häufig nur für eine privilegierte Schicht erschwinglich, da es zu wenig öffentlich finanzierte Institutionen gibt. Dass die Absolventinnen wenig Bezug zur Lebenswirklichkeit von Werktätigen, Reinigungs- und Servicekräften haben, scheint einerseits einleuchtend, andererseits aber wird ihre Alltagserfahrung auch nicht mit jener von Aliens und Superhelden übereinstimmen, welche trotzdem fortwährend repräsentiert werden.
Was, wenn die weitreichende Abwesenheit von Arbeiterinnen und deren Arbeitsleben gar nicht so sehr soziologisch, sondern vielmehr filmisch und rezeptionsästhetisch zu erklären ist? Bevor wir über Hollywood schimpfen, sollten wir deshalb zunächst uns selbst mit einer unangenehmen Frage konfrontieren: Wollen wir im Film wirklich Arbeiter arbeiten sehen?
Plackerei zur Primetime
Am 31. März dieses Jahres ereignete sich auf Prosieben ein besonderer Fernsehabend: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf präsentierten die komplette Arbeitsschicht der Krankenpflegerin Meike Ista im Knochenmarktransplantationszentrum des Universitätsklinikums Münster. 402 Minuten – ohne Werbeunterbrechung – zeigte die von Ista umgeschnallte Bodycam, wie sie Utensilien desinfiziert, Handschuhe an- und auszieht, Pflaster wechselt, Patienten hilft und ihnen Mut zuspricht. Näher konnte man als Fernsehzuschauer dem Arbeitsalltag in der Pflege nicht kommen. Selbstverständlich wurde die Sondersendung in erster Linie als Statement rezipiert – als ein Aufschrei für bessere Bedingungen und höhere Löhne im Pflegeberuf. Dem lässt sich nichts als zustimmen – widmen wir uns also einer anderen Frage: Wer hat sich das wirklich angesehen?
Laut Quote viele: im Durchschnitt 730.000 Menschen. Mit 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-Jährigen war Prosieben sogar der erfolgreichste Sender in der Zielgruppe. Zahlen sagen hier aber wenig aus. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Fernbedienung demonstrierten wollten, dass sie – im Gegensatz zur herrschenden Politik – die Pflegearbeit würdigen. Niemand würde sich sonst freiwillig Stunde um Stunde einen Arbeitsalltag ansehen, der aus vielen Routinen und Wiederholungen besteht und keiner klassischen Spannungsdramaturgie folgt. Es ist schlichtweg langweilig. Und würde der Privatsender nun jede Woche auf diese Art einen anderen Berufsalltag vorstellen, lägen seine Quoten rasch im nicht mehr messbaren, unteren Bereich.
Nun wird man dagegenhalten, dass DIY-Videos sehr beliebt sind, in denen Menschen basteln und bauen. Oder denken wir auch an die Videos, in denen man Maschinen dabei beobachten kann, wie sie Felder pflügen. Solche Videos werden natürlich nicht der Spannung wegen rezipiert, sie sind visuelle Beruhigungsmittel. In Asien gibt es den Trend, dass man Menschen dabei zusehen kann, wie sie am Schreibtisch arbeiten, was einen selbst aus der ewigen Prokrastination befreien soll – es handelt sich im Prinzip um virtuelle Coworking-Spaces. Wie aber ist es mit dem Reality-TV, das gelegentlich Hebammen oder Polizisten bei der Arbeit zeigt? Davon abgesehen, dass diese Formate vor allem der Nebenbeiunterhaltung dienen und nicht den konzentrierten Zuschauer voraussetzen, sind die Sendungen dramaturgisch stark aufbereitet: Man setzt auf Storytelling, dramatisiert selbst Nicht-Ereignisse und arbeitet mit Stereotypisierungen.
Das europäische Kunstkino hat immer wieder versucht, Arbeit und Arbeiter möglichst naturalistisch zu zeigen. Solche Werke wurden bisweilen mit überschwänglicher Begeisterung von einem Publikum aufgenommen, das ähnlich wie das von Prosieben verfährt, insofern es die Botschaft, nicht das Werk rühmt – mit dem Unterschied, dass jenen Cinephilen die dargestellten Arbeitswelten beinahe exotisch erscheinen müssen, während sich vor dem TV wohl recht viele Zuschauerinnen und Zuschauer unmittelbar identifizieren konnten. Die film- und medienwissenschaftlichen Debatten über den politischen Gehalt des dokumentarischen oder zumindest unverstellten, ungeschönten Blicks auf prekäre Arbeit füllen unzählige Sammelbände.
Die »Betroffenen« wissen von diesen Filmen hingegen nichts – die Glücklichen! Wenn ich mir auf Filmfestivals, in Programmkinos und in einsamen Sitzungen vor dem Fernseher daheim stundenlang ansah, wie Menschen aus aller Welt Brotteig kneten, Schafe scheren, Alte waschen, Dächer decken, an Fließbändern Ausschussware herausfischen, dann fragte ich mich häufig: Ist das die ausgleichende Gerechtigkeit? Die einen müssen diese Arbeit tun, die anderen sie sich ansehen? Jedenfalls sollte man niemals von einem Arbeiter verlangen, dass er sich am Feierabend eines harten Tages einem solchen Film aussetzt.
»Aber Ken Loach!«, werden nun manche einwenden. Zweifelsohne ist der britische Regisseur ein Meister des sozialen Dramas. Loach ist immer dann genial, wenn er seine Filme – wie etwa in Looking for Eric oder Angel’s Share – fürs Poetische öffnet und Utopien konkret werden lässt, oder wenn er wie in Ich, Daniel Blake die Solidarität der Unterdrückten beschwört. Hingegen wird es fade, wenn er schlicht die Ungerechtigkeit des Kapitalismus abbildet – wie in Sorry We Missed You, der die Schufterei eines gegängelten Paketboten begleitet. Ein wichtiger Film – das ist schnell gesagt –, doch fragt sich für wen. Mein Paketbote, der mir die DVD brachte, wird ihn sich jedenfalls nicht ansehen. Und ich weiß ohnehin Bescheid – trotzdem habe ich den Film beim reichsten Mann der Welt bestellt.
»Ist das die ausgleichende Gerechtigkeit? Die einen müssen diese Arbeit tun, die anderen sie sich ansehen?«
1986 veröffentlichte die Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin den Essay »Die Tragetaschentheorie des Erzählens«, in dem sie erläutert, dass die Geschichten des Abendlandes nahezu allesamt von Helden und ihren Taten handeln, andere Formen der Arbeit dabei jedoch nicht vorkommen. »Es ist schwer, eine wirklich packende Geschichte davon zu erzählen, wie ich erst einer wilden Haferspelze ein Haferkorn abgerungen habe und dann noch einer und dann noch einer und dann noch einer und dann noch einer«, schreibt sie.
Gleiches lässt sich auch für die additive Struktur sowohl des Prosieben-Events als auch des Loach-Films sagen. Dennoch hält Le Guin das Schreiben solcher Geschichten für erstrebenswert, da ein Roman eigentlich wie eine Tragetasche sei, in dem sich völlig unheroisch alles sammeln ließe. Das mag sein, Adalbert Stifter bewies es im Nachsommer, und auch Peter Handke schreibt grandios über das Pilzesammeln. Für den Unterhaltungsfilm aber – und nur dieser wird unter heutigen Bedingungen die Arbeiterklasse erreichen – ist eine spannende Handlung unabdingbar. Spannend aber sind nur drei Formen der Darstellung: Ausnahmezustand, Allegorisierung und Widerstand.
Klassenkämpfe in Hollywood
Im ersten Fall werden Leben und Arbeit in einer Notsituation gezeigt. Michael Bays Armageddon und Wolfgang Petersens Der Sturm sind Arbeiterfilme par excellence, insofern sie die körperliche Arbeit als systemrelevant exponieren. Bay lässt Arbeiter von einer Bohrinsel zu Astronauten umschulen, damit sie auf einem auf die Erde zurasenden Asteroiden eine Atombombe platzieren können. Und Petersen lässt nicht nur ausgebeutete Tagelöhner heldenhaft gegen einen Wirbelsturm kämpfen, sondern auch fragen: Warum müssen eigentlich Fischer auf hoher See ihr Leben riskieren, während der im Trockenen sitzende Kapitalist, nämlich der Schiffseigentümer, den Mehrwert einsteckt?
In der Pandemie ist längst klar geworden, dass die Bundesregierung – in enger Abstimmung mit »der Wirtschaft« – wie der Ausbeuter in Der Sturm verfährt: Die prekär Beschäftigten müssen an die Front, um Profite zu erwirtschaften, und infizieren sich folglich wesentlich häufiger – den Unternehmern hingegen will man nicht einmal eine Schnelltestpflicht zumuten.
Das bringt uns zur zweiten Darstellungsform: der Allegorisierung. Parasite von Bong Joon-ho ist zum einen ein atemberaubender Thriller und zum anderen ein Lehrstück im Brecht’schen Sinne, das die kapitalistischen Verhältnisse so glänzend analysiert, dass es auch ein nicht mit der Marx’schen Theorie vertrautes Publikum begreift. Dabei nimmt Parasite die aktuelle Krise vorweg: Nach einem Unwetter steht die gesamte Wohnung der armen Familie unter Wasser und sie verliert ihr letztes Hab und Gut, während die hoch über der Stadt lebende reiche Familie sich freut, dank des heftigen Regens endlich einmal wieder richtig frische Luft atmen zu können. Dem entsprechen heute die vielen Artikel und TV-Sendungen, in denen Promi-Intellektuelle schwärmen, dass man während des Lockdowns herrlich entspannen und entschleunigen könne.
Allegorisch arbeitet auch Boots Rileys Sorry to Bother You, der von einem schwarzen Mitarbeiter eines Callcenters handelt, der seine Stimme »weiß« klingen lassen muss, um erfolgreich zu sein. Doch damit nicht genug: Längst arbeitet die Geschäftsleitung daran, ein Mensch-Pferd-Mischwesen zu züchten, das produktiver als jeder Arbeiter ist. Die Ungleichheit wird hier genetisch manifestiert. Davor warnte bereits Francis Fukuyama in seinem Weckruf Das Ende des Menschen: Die Idee der Gleichheit könnte für immer passé sein, wenn wir erst solche Menschen mit Satteln auf dem Rücken und Stiefeln und Sporen an den Füßen züchten können.
In Sorry to Bother You kommt es außerdem zum Arbeitskampf, was uns zur dritten Darstellungsform führt: dem Widerstand. Der Film ist nicht dazu da, die Wirklichkeit – auch nicht die von Arbeiterinnen – bloß zu verdoppeln. Vielmehr soll er eine Alternative aufzeigen. Spannung entsteht, wo Arbeiter aufbegehren, sich widersetzen, revoltieren. Das kann wie in Spike Lees Chi-Raq ein Sexstreik von Chicagoer Frauen sein: Damit die Gewaltherrschaft der Männer endet, verweigern sie die Reproduktionsarbeit. Oder denken wir an Jim Carrey, der in vielen Filmen den idealen Büroangestellten verkörpert, bis plötzlich etwas den Alltag unterbricht und Carrey zum Beispiel als Kreditberater in Der Ja-Sager nichts mehr verneinen kann und nun jedes Darlehen bewilligt oder in Die Truman Show bemerkt, dass die bunte Konsumwelt ein falsches Bewusstsein erzeugt und bloß eine Simulation ist.
Erst durch die Reibung entsteht gutes Kino, das auch jene erreicht, die gern mehr Lohn, kürzere Arbeitszeiten, kurzum: ein besseres Leben hätten. Die Hoffnung ist nicht unberechtigt, dass der populäre Arbeiterfilm eine kritische Reflexion nicht nur über die ungerechten Verhältnisse, sondern auch über die Ideologie der Kulturindustrie ermöglicht. Wenn es in Brechts berühmtem Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« heißt: »Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen«, könnte die eines sehenden Arbeiters bald lauten: Wer baute die Waffen, Rüstungen und Spaceshuttles der Marvel- und DC-Superhelden?