18. Dezember 2023
Evgeny Morozov: Wir brauchen einen Nicht-Markt-Modernismus
Digitale Technologien haben dem Kapital ermöglicht, immer tiefer in unser Alltagsleben einzudringen. Doch sie ließen sich auch einsetzen, um Alternativen zum Neoliberalismus aufzubauen, meint Evgeny Morozov im Interview.
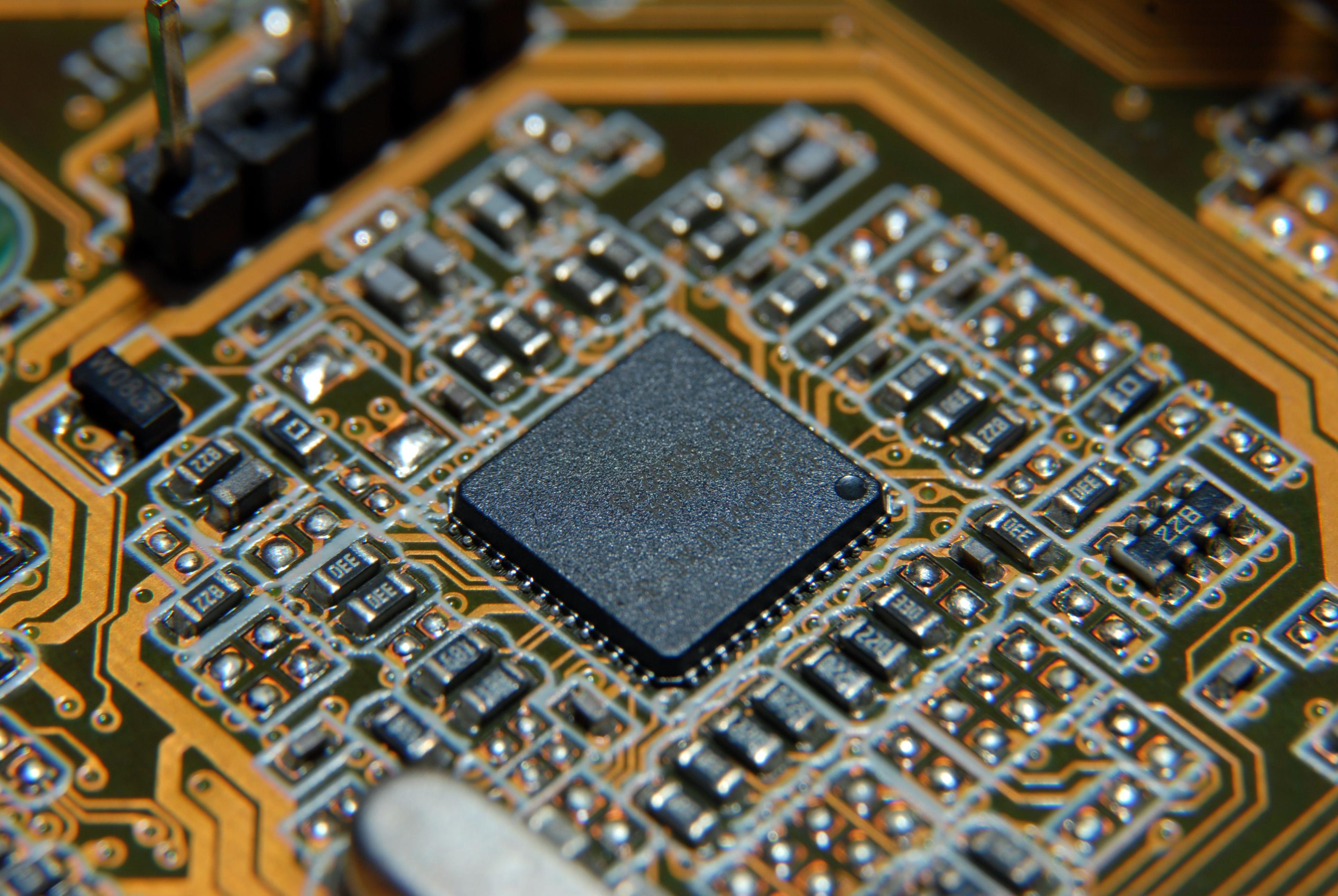
Unsere heutige Technologie lässt auch andere Verknüpfungsmethoden zu als den Markt.
Evgeny Morozov befasst sich seit über einem Jahrzehnt mit Transformationen und Entwicklungen, die durch das Internet ausgelöst wurden. Bekannt wurde er mit zwei preisgekrönten Büchern, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom (2012) und To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism (2013). Er beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Technologie, politischer Ökonomie und Philosophie.
Morozov ist Gründer der Wissensplattform The Syllabus. Sein neuestes Projekt ist The Santiago Boys, ein neunteiliger Podcast, der sich mit dem experimentellen chilenischen Modell des Sozialismus beschäftigt, das 1970–73 von Präsident Salvador Allendes Unidad Popular geführt wurde. Der Podcast erzählt vom Streben radikaler Ingenieure nach nationaler technologischer Souveränität, von der Entwicklung des Cybersyn-Projekts zur staatlichen Planung der Wirtschaft und vom Kampf des Landes gegen ITT, den großen multinationalen Technologiekonzern der damaligen Zeit.
Morozov hat seine Arbeit kürzlich in Brasilien, Chile sowie Argentinien vorgestellt und seine Tournee dann in New York mit einer Veranstaltung mit JACOBIN beendet. Das Interview führte Simon Vázquez.
Du hast in mehreren Interviews betont, es sei notwendig, Arbeiterinnen und Arbeiter im Bereich technische Entwicklung mitentscheiden zu lassen, statt einfach darauf zu setzen, dass irgendwie schon adäquate technische Lösungsansätze entstehen werden. Was sind die Probleme, wenn technische Visionen und Neuerungen eingeführt werden, die von der breiten Masse nicht mitgetragen werden?
Die technokratische Lösung für die heutige digitale Wirtschaft kommt meist von der neoliberalen Rechten oder der Mitte. Diese betonen die Notwendigkeit, die Plattformen und deren Tätigkeiten zu überwachen, um den Wettbewerb zu verbessern und den Verbrauchern die Wahl und den Wechsel zwischen Plattformen zu erleichtern. Solche Lösungen sind in Europa traditionell stärker verbreitet als in den USA. Das hat zum einen ideologische Gründe – unter dem Einfluss der Chicago School waren die USA bei der Durchsetzung von Kartellvorschriften immer recht lax – und zum anderen geopolitische Gründe: Washington will seine eigenen Unternehmen nicht überregulieren, weil es befürchtet, dass diese dann von chinesischen Konkurrenten verdrängt werden könnten.
In Europa ist man also der Ansicht, dass die Probleme der digitalen Wirtschaft durch mehr Regulierung gelöst werden können. Einige dieser Regulierungen könnten natürlich nützlich und notwendig sein, aber ich denke, dass ein solcher technokratischer Ansatz oft auf einer gewissen Blindheit gegenüber Geopolitik und Industriestrategie und sogar der Krise der Demokratie, die wir überall auf der Welt beobachten können, aufbaut. Es ist in Ordnung, wenn neoliberale Technokraten dafür blind sind oder eine solche Blindheit vortäuschen, aber für progressivere und demokratische Kräfte wäre es ein Fehler, sich hinter solche Forderungen zu stellen. Denn die Probleme der digitalen Wirtschaft lassen sich nicht allein durch Regulierung lösen – nicht zuletzt, weil die digitale Wirtschaft, sowohl in ihrer chinesischen als auch in ihrer US-amerikanischen Version, auch nicht allein durch Regulierung entstanden ist.
»Wenn wir in unserer Freizeit im Internet herumdaddeln, »arbeiten« wir auch, denn wir generieren Mehrwert für die Plattformen: Play is work. Arbeit in der modernen Digitalwirtschaft hat andererseits viele spielerische Elemente: Work is play.«
In der Linken, genauer gesagt unter Sozialistinnen und Sozialisten, gibt es eine Debatte über Planung und Technologie. Diese hat in den vergangenen Jahren zur Entstehung der Strömung des »Cybersozialismus« geführt. Kannst Du Dich damit identifizieren? Oder welche Kritikpunkte würdest Du dagegen vorbringen?
Mein Hauptkritikpunkt ist, dass dieses Konzept gleichzeitig zu eng und zu weit gefasst ist. Wie ich es verstehe, ist es ein Versuch, mathematische Modelle und Berechnungen einzusetzen, um das zu verwalten, was Karl Marx das »Reich der Notwendigkeit« nannte. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass ein solcher Ansatz für grundlegende Güter, die für ein gutes Leben notwendig sind – Wohnung, Kleidung, Nahrung – sinnvoll und notwendig sein kann. Wir müssen jedoch auch die strikte Unterscheidung bedenken, die Marx zwischen diesem »Reich der Notwendigkeit« und dem Sprung in das »Reich der Freiheit« zieht. Letzteres lässt er leider weitgehend undefiniert. Dabei finden gerade dort Kreativität und Innovation statt, während das Reich der Notwendigkeit vor allem das Reich der reinen gesellschaftlichen Reproduktion ist. Wie Marx lässt auch der Cyberkommunismus das Reich der Freiheit unbestimmt und hat daher keine klare Vorstellung davon, was Computer in Bezug auf kreativere Tätigkeiten leisten könnten.
Beim Neoliberalismus ist das anders. Der Neoliberalismus beginnt damit, dass er eine strikte Unterscheidung zwischen diesen beiden Reichen ablehnt und argumentiert, dass der Markt sowohl ein System zur Befriedigung unserer Grundbedürfnisse als auch eine Infrastruktur zur Verwaltung und Zähmung von Komplexität ist – und so eine Quelle des Neuen, Kreativen und Unerwarteten. In der heutigen Digitalwirtschaft wird diese »Verschmelzungslogik« anschaulich: Wenn wir in unserer Freizeit im Internet herumdaddeln, »arbeiten« wir auch, denn wir generieren Mehrwert für die Plattformen: Play is work. Arbeit in der modernen Digitalwirtschaft hat andererseits sehr viele spielerische Elemente: Work is play. Das ist ein gänzlich anderes Arbeiten als in einem Werk in der fordistischen Ära.
Die Linke lehnte eine solche Verschmelzung der beiden Reiche traditionell ab. Doch vielleicht sollte sie eine solche Verschmelzung annehmen? Wenn sie dies tut, wäre die nächste Frage: Ist der traditionelle Gegenpol zum neoliberalen Markt – also der mathematisch berechnete Plan – als zentrales Merkmal des Wirtschaftssystems wirklich ausreichend, wenn er doch gar nichts im Reich der Freiheit zu erreichen sucht?
Um es auf einer höheren Abstraktionsebene zu sagen, der Neoliberalismus ist eine Marktzivilisation: Er verknüpft die Fortschrittslogik einer immer komplexeren und sich stetig verändernden Gesellschaft mit dem Markt als Hauptinstrument, um dies zu verwirklichen und zu regeln. Ein anderer Name dafür wäre »Markt-Modernismus«. Um dieser Art von Zivilisation etwas entgegenzusetzen, brauchen wir eine Art »Nicht-Markt-Modernismus«. Der Cyberkommunismus macht das mit dem »Nicht-Markt« ganz gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob er auch nur annähernd versteht, dass der »modernistische« Teil der Gleichung ebenfalls eine Herausforderung ist, die es zu lösen gilt.
Wir haben hier auch über die Erfahrungen des Projekts Cybersyn debattiert – dem chilenischen Versuch, in einer Prä-Internet-Zeit mit Computerberechnungen die Wirtschaft zu organisieren und zu planen. Warum sollten wir fünfzig Jahre später noch über ein »Was wäre, wenn…« sprechen, über Wege, die damals nicht weiter beschritten wurden, oder besser gesagt: nicht weiter beschritten werden konnten?
Daran zu erinnern und darüber zu sprechen ist wichtig, weil man so die globale Öffentlichkeit dafür sensibilisiert, dass die digitale Wirtschaft und die digitale Gesellschaft, wie wir sie heute haben, nicht das Ergebnis irgendeiner »naturgegebenen« Tendenz ist, die sich aus Technik und Internet-Protokollen einfach so ergeben musste. Vielmehr ist die heutige Digitalwirtschaft und -gesellschaft das Ergebnis geopolitischer Kämpfe mit Gewinnern und Verlierern. Ich glaube, es ist nicht korrekt, Cybersyn als eine alternative Technologie-Infrastruktur zu betrachten, denn letztendlich war weder das Telex-Netzwerk noch die verwendete Software einzigartig oder sonderlich revolutionär.
»Das Einzigartige an Cybersyn ist, dass es Teil von Salvador Allendes Bemühungen werden sollte, Unternehmen zu verstaatlichen, die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Chiles als strategisch wichtig galten.«
Besser ist es, Cybersyn als einen Teil eines vorgeschlagenen alternativen Wirtschaftssystems zu betrachten, bei dem Computer zur besseren Verwaltung von Unternehmen im öffentlichen Sektor eingesetzt werden konnten. Ähnliche Managementsysteme gab es in der Privatwirtschaft schon lange: Stafford Beer, der führende Kopf hinter Cybersyn, hat diese Art der Verwaltung und Planung bereits ein Jahrzehnt vor Cybersyn in der Stahlindustrie gepredigt.
Das Einzigartige an Cybersyn ist also nicht das Technologische, sondern, dass es Teil von Salvador Allendes Bemühungen werden sollte, Unternehmen zu verstaatlichen, die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Chiles als strategisch wichtig galten. Das Ganze basierte auf einer interessanten Mischung aus Strukturökonomie im Sinne der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) und Dependenztheorie. Das Ende dieses politischen Projekts – nicht nur von Cybersyn an sich – ist zu betrauern. Deshalb habe ich in meinen Äußerungen nach der Veröffentlichung des Podcasts so sehr auf die Existenz einer »Santiago School of Technology« [als Gegenstück zur Chicago School of Economics] hingewiesen. Sobald wir erkennen, dass Allende und viele der Ökonominnen und Diplomaten um ihn herum eine Vision für eine komplett andere Weltordnung hatten, bekommt Cybersyn eine ganz neue Bedeutung. Es wird zu der Software, die dabei helfen sollte, diese Vision daheim in Chile zu verwirklichen.
Mit dem Podcast bietest Du eine Gegen-Geschichte der Chicago Boys. Du argumentierst auch, dass die Boys in Wirklichkeit nicht Innovatoren ihrer Zeit waren, sondern ihre Arbeit darauf beschränkt war, in Zusammenarbeit mit dem späteren Diktator Augusto Pinochet die technologische Entwicklung Chiles und die Ideen der »Santiago Boys« für eine Alternative zum neoliberalen Modell zu torpedieren.
Während der Präsidentschaft von Eduardo Frei Montalva, dem Vorgänger von Allende, und natürlich während Allendes eigener Regierungszeit hatten diese chilenischen Wirtschaftswissenschaftler, die wir als Chicago Boys kennen, diverse Kritik vorzubringen. Eine davon betraf den korrupten Charakter des chilenischen Staates. In diesem Zusammenhang wurde kritisiert, dass verschiedene Interessengruppen ihre Verbindung zum Staat ausnutzten, um bevorzugt behandelt zu werden und sich vor Konkurrenz zu schützen. Die andere Kritik bezog sich auf die politischen Vorgaben, die aus der CEPAL und der Dependenztheorie hervorgingen. Warum den Chicago Boys diese Konzepte missfielen, ist klar: Die meisten dieser Maßnahmen widersprachen der Idee, dass die wirtschaftliche Entwicklung dem Markt überlassen werden sollte.
So sahen einige der Chicago Boys die Allende-Periode gar nicht so sehr als Ursache einer tieferen Krise der chilenischen Gesellschaft und Wirtschaft, sondern als deren Folge. Sie interpretierten die vielen Arbeiterinnen und Bauern, die das Parteienbündnis von Allende, die Unidad Popular, gewählt hatten, nur als eine der vielen Interessengruppen, die in einem als korrupt und gespalten empfundenen Staatssystem für ihre Interessen kämpften.
Ich halte ich es für einen Fehler, die Chicago Boys als scharfsinnige und bahnbrechende Ökonomen zu betrachten, die Chile mit einer kräftigen Dosis Neoliberalismus gerettet hätten. Die Unidad Popular hat zwar einige Fehler bei der Führung der Wirtschaft gemacht, aber sie hatte eine kohärente politische Vision davon, was Chile tun sollte, um ein unabhängiger, autonomer und gut entwickelter Staat in der Weltwirtschaft zu sein. Manche mögen sagen, dass Chile dies ja später auch geworden ist. Ich denke aber, dass Chile nicht so weit gekommen ist, wie es hätte kommen können. Hätte Chile die Rezepte der Santiago Boys befolgt, wäre es heute vielleicht vergleichbar mit Südkorea oder Taiwan, also Ländern, die in technologischer Sicht weit über ihrem (geo-) politischen Gewicht liegen.
Im Podcast sprichst Du auch über die Tradition der Dependenztheorie. In Deiner vorherigen Antwort hast Du angedeutet: Wenn Allendes Projekt hätte durchgezogen werden können, wäre ganz Lateinamerika heute womöglich gerechter und reicher. Chile wäre eine alternative Technologie-Macht mit einem anderen technologischen Entwicklungsmodell als dem des Silicon Valley. Was kann uns die Dependenztheorie angesichts aktueller Debatten in der Digitalwirtschaft lehren?
Die Dependenztheorie ist die radikale Weiterführung der CEPAL-Strukturökonomie, die traditionell die Wichtigkeit von Industrialisierung predigte. Das ist nicht wirklich anders als bei irgendwelchen Digitalgurus heute, die eben die Wichtigkeit von Digitalisierung predigen. Die Dependenztheoretiker erkannten jedoch, dass Industrialisierung an sich nicht das Hauptziel sein kann. Das Hauptziel muss wirtschaftliche und soziale Entwicklung sein. Und sie fanden heraus, dass die Beziehung zwischen Industrialisierung und Entwicklung eben nicht linear ist.
»Eine Digitalisierung, die ohne eine vorherige Verpflichtung zur nationalen digitalen Souveränität durchgeführt wird, schafft neue Abhängigkeiten und Hindernisse für die weitere Entwicklung.«
Das bedeutet: Manchmal kann mehr Industrialisierung – die ja oft als Euphemismus für ausländische Direktinvestitionen diente – tatsächlich mehr Entwicklung bedeuten. Doch manchmal kann sie nun einmal auch keine Entwicklung oder sogar Unter-/Rückentwicklung bedeuten. In dieser Debatte gab es allerlei Zwischenbegriffe wie Fernando Henrique Cardosos »assoziierte Entwicklung« oder »abhängige Entwicklung«. Damit sollte gezeigt werden, dass sich sogenannte Entwicklungsländer auch dann entwickeln können, wenn die Industrialisierung hauptsächlich von ausländischem Kapital angeführt wird. Die radikaleren Theoretiker wie Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos und Andre Gunder Frank vertraten hingegen die Ansicht, dass technologische Autonomie – also die Entwicklung einer eigenen technologischen Basis im Land – eine Voraussetzung für eine Industrialisierung ist, die zu einer wirklich sinnvollen Entwicklung führen kann.
Aus heutiger Sicht würde das bedeuten, dass eine Digitalisierung, die ohne eine vorherige Verpflichtung zur nationalen digitalen Souveränität durchgeführt wird, wahrscheinlich neue Abhängigkeiten und Hindernisse für die weitere Entwicklung schaffen wird. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass Länder aktuell schon riesige Rechnungen für Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Mikrochips und so weiter schlucken müssen. Die Abhängigkeiten sind natürlich nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch geopolitischer Natur. Das erklärt, warum die USA sich so aggressiv gegen China wehren: Sie wollen technologische Souveränität in Bereichen wie 5G und Mikrochips erlangen.
Aus der Forderung, ungleiche (Wirtschafts-) Beziehungen zu beseitigen, ergeben sich natürlich weitere Fragen nach Planung der heimischen Industrie und wie der Staat die Entwicklungsprozesse lenken kann oder soll. Welchen Beitrag haben Stafford Beer und die chilenischen Techniker Deiner Meinung nach geleistet, um das politische Konzept einer kybernetischen Verwaltung zu verstehen, wenn nicht sogar aktiv zu planen?
Die Fragen, die Beer sich stellte, entspringen nicht den herkömmlichen Fragen nach Verteilung, die normalerweise in Debatten über nationalstaatliche Planung auftauchen würden. Vielmehr sind seine Fragestellungen auf seinen Hintergrund in der Unternehmenswelt zurückzuführen, wo Planung eher bedeutet, darüber nachzudenken, wie man sich an eine Zukunft anpasst, die sich ständig verändert. In diesem Sinne sind Unternehmen meist bescheidener als Nationalstaaten: Sie nehmen die Zukunft so an, wie sie ist, anstatt zu denken, dass man sie nach den eigenen nationalen Zielen zurechtbiegen kann. Eine der Folgen dieser von Beer praktizierten »Bescheidenheit« war die Erkenntnis, dass die Welt immer komplexer wird, aber dass Komplexität eine gute Sache ist – solange wir die richtigen Tools haben, um ihre Auswirkungen zu bewältigen. Hier kamen Computer und Echtzeitnetzwerke ins Spiel.
Das ist ein Teil, den ich an Cybersyn immer noch sehr wichtig finde: Wenn wir akzeptieren, dass die Welt immer komplexer werden wird, müssen wir adäquate Verwaltungstools entwickeln. Dabei geht es nicht nur um Allokations- und Planungsinstrumente. Ich finde es wirklich gut und nützlich, bescheiden zu sein, was die eigene Fähigkeit angeht, die Zukunft vorherzusagen und sie dann nach seinem Willen zu gestalten. Vor allem widerspricht man damit der üblichen Versuchung der Moderne, sich wie ein allwissender und allmächtiger Gott aufzuführen.
Stafford Beer sprach in seinen Büchern über die Gestaltung von Freiheit; Du sprichst von »Planung der Freiheit« und der Lenkung oder Kontrolle von Komplexität. Kannst Du näher erläutern, wie diese Agenda ins »Reich der Freiheit« führt, das Du vorhin erwähnt hattest?
Wie ich schon sagte, hat Beer zur traditionellen sozialistischen Agenda mit ihrem staatsorientierten Fokus auf die Befriedigung der unmittelbarsten Bedürfnisse der Bevölkerung beigetragen, indem er gezeigt hat, dass Computer auch im Reich der Freiheit eine Menge leisten können. Sie sind nicht nur Werkzeuge, die im Reich der Notwendigkeit eingesetzt werden können. Beers Gedanken stehen gegen diese technikfeindliche Haltung, die bei einigen Linken auch heute noch verbreitet ist. Er war der Meinung – zu Recht, wie ich finde – dass es zu höchst ineffizienten und unerwünschten Ergebnissen führt, wenn man Fragen nach Technologie und Organisation einfach ignoriert.
»Die Linke sollte über alternative, nicht-neoliberale Wege nachdenken, um eine ähnliche oder vielleicht sogar bessere Infrastruktur für die gesellschaftliche Koordination zu schaffen.«
Wir wissen das intuitiv, deshalb setzen wir ja recht einfache Technologien wie Verkehrsampeln oder Fahrpläne ein, um die gesellschaftliche Koordination zu verbessern, um Chaos zu vermeiden. Doch vielleicht müssen solche Technologien gar nicht so einfach sein. Könnten sie nicht viel fortschrittlicher und digitaler sein? Warum sollte man der neoliberalen Behauptung Glauben schenken, dass die einzige Möglichkeit, gesellschaftliches Handeln in großem Maßstab zu koordinieren, der Markt ist? An diesem Punkt ist Beers Ansatz meiner Meinung nach sehr nützlich. Wenn wir von einem flexiblen, plastischen Menschen ausgehen, der sich ständig weiterentwickelt, dann wollen wir ihm doch gerne die Mittel an die Hand geben, mit denen er sich selbst (und die von ihm gebildeten Kollektive) in neue, völlig unerwartete und unerprobte Richtungen und Dimensionen voranbringen kann.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Silicon Valley diesen Weg eingeschlagen, bevor es die Linken konnten. Deshalb haben wir heute Tools wie Whatsapp und Google Calendar, die die Koordination von Millionen Menschen erleichtern. Das hat einen alles andere als trivialen Einfluss auf die Gesamtproduktivität! In diesem Fall kommt es also zu gesellschaftlicher Koordination, mehr Komplexität wird produziert, und die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Doch all das geschieht – entgegen dem neoliberalen Narrativ – nicht über das Preissystem, sondern über Technologie und Sprache.
Wie wir langsam feststellen, ist dieses Modell aus dem Silicon Valley allerdings nicht ohne Kosten, auch in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Man denke nur an die Verbreitung von Desinformation im Internet oder an die Konzentration von KI-Fähigkeiten – und damit all den Daten, die produziert und gesammelt werden – in den Händen einiger Konzernriesen. Diese neoliberale Art der Organisation hat also einen hohen Preis, wenn auch erst auf den zweiten Blick. Die Linke sollte über alternative, nicht-neoliberale Wege nachdenken, um eine ähnliche oder vielleicht sogar bessere Infrastruktur für die gesellschaftliche Koordination zu schaffen.
Warum haben Sozialistinnen und Sozialisten diese Ansätze lange Zeit nicht verfolgt? Hat das vielleicht etwas mit der gefühlten »intellektuellen Niederlage« des Marxismus im Kalten Krieg zu tun? Oder wurde den Debatten im Globalen Süden nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt?
Ich denke, die Antworten haben vor allem mit der intellektuellen Sackgasse zu tun, in der sich sowohl der westliche Marxismus als auch seine radikaleren Versionen befinden. Das gemäßigtere Lager hat sich auf die neoliberale Dichotomie zwischen Markt und Plan eingelassen und den Markt spätestens mit dem Ende der Sowjetunion als überlegene Form der gesellschaftlichen Koordination akzeptiert. Jemand wie Jürgen Habermas ist ein gutes Beispiel für diese Haltung: Er akzeptiert die zunehmende Komplexität gesellschaftlicher Systeme, aber er kann sich einfach keine Alternative zu Markt und Gesetz vorstellen, um diese Komplexität zu reduzieren. Technologie ist in dieser Sichtweise nichts anderes als angewandte Wissenschaft.
Die radikaleren Strömungen – die dann im Cyberkommunismus gipfeln – haben sich oftmals nicht vollständig mit der Kritik an der sowjetischen Planwirtschaft und deren Unvereinbarkeit mit liberaler Demokratie auseinandergesetzt. Ich verweise da auf Leute wie György Márkus, der, ohne dem Marxismus abzuschwören, viele tiefgreifende Kritiken darüber geschrieben hat, was Marxisten in Bezug auf – um Engels zu zitieren – den Übergang zur »Verwaltung der Dinge« im Kommunismus falsch verstehen.
Es gibt auch eine gewisse naive Sichtweise der Marxisten auf die Technologie, wenn weiter auf der Maximierung der Produktivkräfte beharrt wird. Tatsächlich ist dieses Ziel etwas, das nur durch die Abschaffung der Klassenverhältnisse im Kommunismus erreicht werden kann. Solche Ansätze verkennen, dass allein schon das Streben nach Effizienz höchst politisch ist: Was für die einen effizient ist, kann für die anderen ineffizient sein. Die Behauptung, dass es für jede Technologie eine Art objektives Optimum gibt, auf das wir hinarbeiten müssen, scheint mir ein Irrweg zu sein. Das ist einfach nicht das, was wir aus der Wissenschafts- und Technikforschung bereits wissen.
Damit will ich nicht sagen, dass solche Werte-Konflikte am besten durch den Markt gelöst werden können – absolut nicht. Aber ich sehe eben auch keinen Mehrwert, wenn Marxisten ignorieren, dass diese unterschiedlichen Sichtweisen existieren. Wenn wir akzeptieren, dass sie existieren, dann können wir auf eine Optimierung der Systeme hinarbeiten, die weitere Ziele als nur Effizienz beinhalten. Vielleicht sollte das Ergebnis öffentlicher Politik die Entstehung vielseitiger Interpretationen einer bestimmten Technologie sein, damit in den Gemeinschaften, die sie nutzen, wiederum neue Interpretationen der Technologie und ihrer Anwendung entstehen können.
»Wir haben nicht das richtige System von Anreizen und Rückkopplungsschleifen, um diese Innovationen zu verbreiten und sie in andere Teile der Gesellschaft zu tragen.«
Einige marxistische Denker wie beispielsweise Raymond Williams haben Komplexität als einen Wert betrachtet, den die Linke bewusst nutzen sollte. »Einfachheit« als übergreifendes Ziel lässt sich nur schwer mit progressivem Denken, mit einer Ideologie des Neuen und Anderen vereinbaren. Ich glaube, Williams hat Recht: Die Antwort auf mehr Komplexität liegt in einer umfassend verstandenen Kultur.
Das bedeutet: Anstatt den Neoliberalen zu entgegnen, dass die richtige Alternative zum Markt der Plan ist, sollte die Linke vielleicht argumentieren, dass die richtige Alternative zur Wirtschaft die Kultur ist, und zwar nicht nur Hochkultur, sondern auch eine Alltagskultur. Schließlich ist diese Kultur – oder sind diese Kulturen – genauso produktiv bei Innovationen wie »die Wirtschaft«. Wir haben nur nicht das richtige System von Anreizen und Rückkopplungsschleifen, um diese Innovationen zu verbreiten und sie in andere Teile der Gesellschaft zu tragen. Das ist es, was der Kapitalismus am besten kann: Er sorgt für die Verbreitung von Innovationen und Ideen – aber es sind eben die Innovationen einzelner Unternehmer.
In der EU, den USA und China gibt es Debatten über »technologische Souveränität«. Dabei geht es meist um den Wunsch, die heimischen Industrien zu schützen und somit in gewisser Weise dem »freien Weltmarkt« mit seiner Konkurrenz zu entkommen. Du hast von digitaler Autonomie und Souveränität gesprochen. Was ist für diese Souveränität vonnöten?
Nun, die Antwort darauf hat vermutlich ein pragmatisches Element sowie ein utopisches Element. Ganz pragmatisch: Ich glaube nicht, dass technologische Souveränität in naher Zukunft erreichbar ist, ohne auf eine Art inländisches Gegenstück zu den US-amerikanischen und chinesischen Anbietern der entsprechenden Dienstleistungen und Produkte zu setzen. Das gilt für Cloud Computing ebenso wie für 5G oder für KI.
Wenn wir uns mehr in Richtung Utopie bewegen, dann sprechen wir über eine Politik, die solche Entwicklungen unterstützt und schützt, allerdings nicht, um Startups und Einzelunternehmer in den Himmel zu loben – wie es Leute wie Emmanuel Macron immer wieder machen – sondern, um damit eine ausgefeiltere Industriepolitik mit breiterem Nutzen zu ermöglichen. Im Fall des Globalen Südens würde dies bedeuten, dass man sich vom traditionellen »Entwicklungsmodell« abwendet, das bisher lediglich auf den Export von Rohstoffen ausgerichtet ist. Sowohl aus utopischen als auch aus pragmatischen Gründen ist es wichtig, diese Diskussion über Technologie mit einer Diskussion über Wirtschaft und Wohlstand zu verknüpfen. Bei dieser Souveränität geht es nicht nur um Innovation oder nationale Sicherheit. Ohne Verweis auf die Wirtschaft sind Debatten über nationale technologische Souveränität immer platt und etwas eindimensional.
Angesichts der aktuellen geopolitischen Kräfteverhältnisse, der Existenz progressiver Regierungen in Lateinamerika und der Konsolidierung der BRICS als potenziell »blockfreie« Bewegung: Glaubst Du, dass der Globale Süden in Zukunft eine Art globaler Vorposten sein kann, eine integrierende Vorhut in Sachen Technologie? Und welche Formen würde Deiner Meinung nach ein digitaler Internationalismus in diesem Kontext annehmen?
Ja, schon. Ich weiß nicht, woher Widerstand gegen die Hegemonie des Silicon Valley sonst kommen sollte. Man muss sich dabei auf regionale und internationale Partnerschaften und Bündnisse verlassen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die damit verbundenen Kosten sonst einfach zu hoch sind. Ein zusätzlicher Faktor ist, dass man sich nicht auf Einzelverhandlungen mit Konzernen wie Google und Amazon einlassen sollte. Ich glaube nicht an die technofeudale These, dass diese Unternehmen nicht so mächtig sind wie Nationalstaaten, aber sie haben eben den US-amerikanischen Staat hinter sich – und oft ist dieser Staat deutlich mächtiger als die Staaten im globalen Süden. Deshalb ist es wichtig, frühere Bemühungen um eine solche Zusammenarbeit, die technologische Souveränität zum Ziel hatten, erneut zu überprüfen und zu bewerten. Der Andenpakt ist das beste Beispiel dafür.
Das Hauptziel dieses von fünf Ländern in Peru unterzeichneten Paktes war die Überwindung von Außenhandelsbarrieren und die Förderung der regionalen Zusammenarbeit, um die Industrialisierung und die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Orlando Letelier, Chiles Außenminister unter Allende, leitete die Verhandlungen. Er betonte, die Ausbeutung durch technologisches Eigentum und die Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen müsse angegangen werden. Letelier schlug vor, eine Art technologisches Äquivalent zum Internationalen Währungsfonds zu schaffen: eben jene Andengemeinschaft. Diese Organisation sollte den Entwicklungsländern Zugang zu technologischen Entwicklungen und zu Patenten verschaffen. Das sind genau die Art von Ideen auf internationaler Ebene, die wir heute brauchen.
Evgeny Morozov ist Wissenschaftler und Autor. Bekannt wurde er mit zwei preisgekrönten Büchern, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom (2011) und To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism (2013). Sein neuestes Projekt ist der Podcast The Santiago Boys.